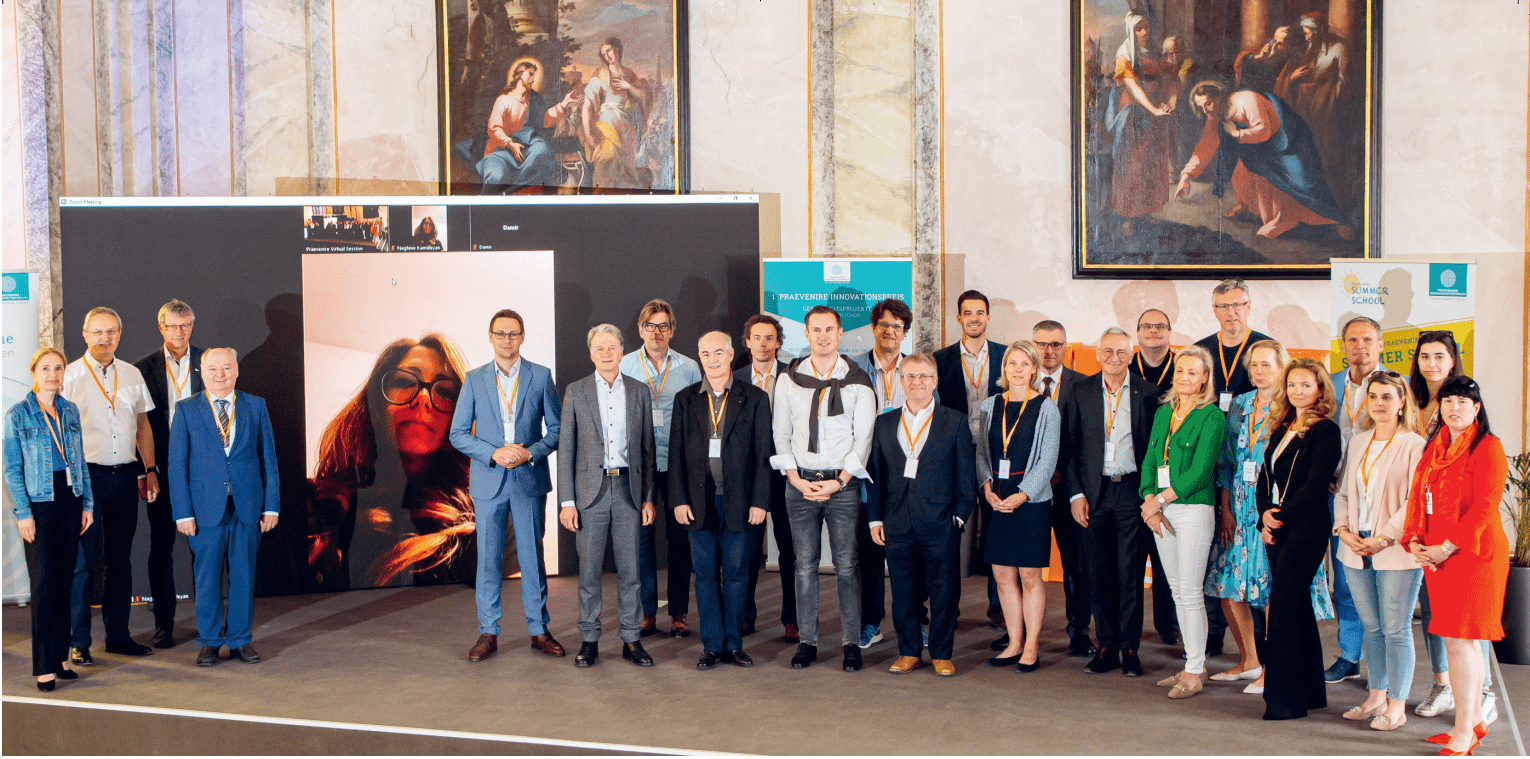Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, der professionellen Benutzerinnen und Benutzer sowie die leichte Anwendbarkeit sind die Schlüsselthemen in Sachen e-health. Die Digitalisierung, auch des österreichischen Gesundheitswesens, wird nur vorankommen, wenn beide Personengruppen zur Verwendung der Tools motiviert werden können. Dafür braucht es auch Zeit, hieß es im Stift Seitenstetten anlässlich des 4. PRAEVENIRE Digital Health Symposiums (16. Mai 2022).

Wolfgang Wagner
Gesundheitsjournalist
Ohne Digitalisierung wird sich jedenfalls in Zukunft eine qualitativ hochwertige
Gesundheitsversorgung nicht mehr durchführen lassen. Doch der Weg ist lang und steinig. Er führt von den jeweils richtigen Daten am richtigen Ort bis zur personalisierten Präzisionsmedizin.
Das Thema liege in der Entwicklung von der Medizin für die Durchschnittspatientin bzw. den Durchschnittspatienten hin zur personalisierten Medizin für das konkrete Individuum“, sagte Dr. Reinhard Riedl (Fachhochschule Bern), Moderator der zweitägigen Veranstaltung zu Beginn. „Dafür müssen zunächst die Daten bereitgestellt werden, wo sie benötigt werden. Sie müssen aber auch benützt werden. Das wäre ELGA plus mit einfachem Zugriff für alle – und zwar lesend und schreibend. Man braucht auch mehr Daten. Die zweite Stufe, so der Experte: „Mehr Verantwortung für die eigenen Gesundheit. Wir wollen zu einer ‚Blended Care‘ kommen, von einer wohnortnahen Versorgung zu einer menschennahen Versorgung mit der Integration von Telemedizin, Apps und maßgeschneiderter Wissensvermittlung.“ Hier gebe es bereits viele Angebote. Könne man in der Psychiatrie doch bereits belegen, dass mit Apps einerseits die Qualität der Versorgung gesteigert, andererseits direkte Arztbesuche und damit Kosten eingespart werden könnten.
Wir haben seit 40 Jahren nationale Gesundheitsdatenregister. Entscheidend ist die demokratische und politisch legitimierte Steuerung.
Morten Elbaek Petersen
Daten erhöhen Überlebensraten
Ein anderes Beispiel sein die Onkologie. „Ein Gesundheitstagebuch kann die Überlebenschancen von Onkologie-Patientinnen und -Patienten bewiesenermaßen erhöhen“ sagte Riedl. Der dritte Schritt sollte dann zu einer personalisierten Präzisionsmedizin führen. Einerseits sollte es die Analyse der individuellen Daten des einzelnen Menschen erlauben, frühzeitig auf sich anbahnende gesundheitliche Probleme zu reagieren, andererseits sollte das gesamte Gesundheitswesen aus der Analyse der anonymisierten Daten vieler Menschen so lernen, dass optimale Versorgung in adäquaten Strukturen angeboten wird. Die Basis dafür müsse eindeutig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ein solches System sein, was Datensicherheit und ihnen zukommenden Nutzen betreffe.
„Es geht darum, Vertrauen zu schaffen, dass die Menschen die Daten nicht erst dann zur
Verfügung stellen, wenn sie von einer Krankheit tödlich bedroht sind“, betonte Riedl. Frühzeitige Analysen sollten sowohl für die Allgemeinheit als auch für den Einzelnen von Nutzen sein. So könne man bis 2030 zu einer „Digital Twin Society“ kommen: Statistische Auswertung einzelner Datensets und statistische Auswertung integrierter Daten.
Vorbild Estland
Während in Ländern wie in Deutschland und Österreich seit mittlerweile rund 20 Jahren über die Vernetzung im Gesundheitswesen – und im Endeffekt über die Digitalisierung – diskutiert
wird, sind andere europäische Länder bereits weiter. Eines davon ist offenbar Estland. „Wir
sind dabei Health 3.0 zu etablieren“, sagte Dr. Madis Tiik, estnischer Allgemeinmediziner und einer der Mitgestalter von E-Health in seinem Land. Die Grundvoraussetzungen: Mit einer Bevölkerung von 1,3 Millionen Menschen ist die Zahl der Anwenderinnen und Anwender
jedenfalls überschaubar. Hinzu kommen gesundheitspolitische Bedingungen. „Wir haben
eine Pflicht-Krankenversicherung, die von den Arbeitgebern bezahlt wird. Sie umfasst alle Menschen. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP liegt bei 6 Prozent. Die Anbieter sind Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner auf privatwirtschaftlicher Basis oder Gesellschaften, Krankenhäuser mit Trägerschaft durch Gesellschaften oder Stiftungen.“ E-Health und Digitalisierung sind in Estland in ein gesamtstaatliches Konzept eingebunden.
„Estland ist schon seit langem sehr aktiv in E-Governance. Jede Bürgerin und jeder Bürger
hat eine elektronische ID. Zugang zum Internet wird als Verfassungsrecht angesehen. 99 Prozent der Menschen haben Internet-Zugang. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein hohes
Vertrauen in ihre E-Identität“, sagte der Experte. Faktisch alle Behördenwege werden seit der Jahrtausendwende über die elektronische X-Road als strengstens abgesichertes System mit jährlich mehr als 900 Millionen Datentransfers angeboten. „Vertraulichkeit, Verfügbarkeit
und Integrität der Daten sind gewährleistet. Estland hat E-Health auch als letztes System gestartet. Das erfolgte erst ab dem Jahr 2009“, sagte Tiik. Auf diese Weise konnte man bereits
auf Erfahrungen und Vertrauen der Benutzerinnen und Benutzer in die zuvor geschaffenen
E-Governance-Werkzeuge aufbauen. Es ist als Opt-Out-Lösung für die Bürgerinnen und Bürger konzipiert.
Geld ist nicht die Lösung
Ein landesweites Gesundheits-Informationssystem, E-Ambulanz, E-Medikation, E-Konsultation, das Buchen von Arztterminen etc., ein eigenes Portal für Patientinnen und Patienten etc. sind enthalten. Seit 2020 wird versucht, über die Technologie auch personalisierte Medizin inklusive der Verwendung von genetischen Informationen (Pharmakogenomik, kardiovaskuläre Risikofaktoren) einzubauen. „Wir wollen auch Evidenz-basierte Unterstützungswerkzeuge für die Therapieentscheidungen der Hausärztinnen und -ärzte haben“, sagte der Arzt. In der nächsten Ausbaustufe – „Health 3.0“ – soll Artifi cial Intelligence – das System noch besser machen. „Geld ist nicht die Lösung, auch nicht Technologie. Wir brauchen Change-Management“, sagte der Arzt.
Vorbild Dänemark
Einen ähnlichen Weg wie Estland ist auch Dänemark gegangen. Dies stellte Morten Elbaek Petersen, Geschäftsführer des dänischen E-Health-Providers Sundhed.dk mit der User-App MinSundhed, dar. Auch in Dänemark sind die Voraussetzungen offenbar gut: ein universeller, freier und gleicher Zugang zum Gesundheitswesen.
„Wir haben aber auch eine gute Zusammenarbeit des Bundes mit den regionalen und den Gemeindeverwaltungen. Seit 40 Jahren erfolgt in Dänemark bereits eine landesweite Sammlung von Gesundheitsdaten in nationalen Gesundheitsregistern. Damit gibt es Gesundheitsdaten buchstäblich ,von der Wiege bis zur Bahre’. Und wir haben ein eindeutiges Identifikationssystem für jeden Bürger und jede Bürgerin“ sagte Petersen.
Die IT-Infrastruktur erlaube einen Datenaustausch über alle Bereiche hinweg. Entscheidend für die Bürger und Bürgerinnen sei aber die demokratische und politisch legitimierte Steuerung des Systems, das allen Benutzerinnen und Benutzern – also Patientinnen und Patienten und Gesundheitspersonal – geregelten und sicheren Zugang gewährleiste. Mittlerweile gebe
es auch ein 2.600 Menschen umfassendes Beratungsgremium für die Weiterentwicklung des Systems. So habe man auch mit dem schnell geschaffenen „Corona Passport“ einen Erfolg beim Management der Covid-19-Pandemie verbuchen können.
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein hohes Vertrauen in ihre E-Identität. Wir brauchen nicht Geld oder Technologie, sondern Change Management.
Madis Tiik
Automatisiertes Arzneimittelmanagement in Linzer Krankenhaus
Ein erfolgreiches Projekt stellte Mag. Gunda Gittler, Leiterin der Anstaltsapotheke des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz, vor. „Wir sind das erste österreichische Krankenhaus, das die gesamte Medikation für jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten verblistert und auf die Stationen bringt“, sagte sie. Seit 2004 gebe es bereits die „elektronische Fieberkurve“ mit der gesamten Patientendokumentation. Die Verordnung der Arzneimittel auf deren Basis erfolge elektronisch unter Mitwirkung klinisch tätiger
Krankenhausapothekerinnen und -apotheker. Dann werden die Medikamente für jede einzelne
Patientin und jeden einzelnen Patienten im „Multi Dose“-Verfahren durch Automaten verpackt. Die Patientinnen und Patienten erhalten damit zu jedem vorhergesehenen Einnahmezeitpunkt die Tabletten etc., die zusammengehören. Das System ist vierfach gegen Fehler abgesichert. Versorgt werden die einzelnen Stationen des Krankenhauses mit rund 200 Betten sowie rund 2.200 Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner. „Wir verblistern sogar geteilte Tabletten“, sagte Gittler. „Pro Monat werden auf diese Weise rund 500.000 Tabletten in 250.000 Blistersäckchen ausgeliefert. Die Fehlerquote beträgt 0,04 Prozent.“
Das sei sozusagen das “Krankenhaus 4.0“, sagte die Krankenhausapothekerin. Für die Patientinnen und Patienten stehe bei dem System die Sicherheit vor Verwechslungen, Dosierungsfehlern etc. im Vordergrund. Auf der anderen Seite erlaubt das Verfahren
ein durchgängiges Arzneimittelmanagement von der Bestellung bis zum Verbrauch. Auch das Pflegepersonal wird dadurch entlastet, weil das „Einschachteln“ von Medikamenten entfällt.
Zu wenig Zuwendungsmedizin durch Digitalisierung?
Die Zukunftsszenarien durch ein digitalisiertes Gesundheitswesen klingen in vielen Aspekten positiv. Doch ohne direkte Kontakte zu Patientinnen und Patienten geht es nicht, betonte Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Hausärztin in Wien-Floridsdorf. Mehr Information müsse nicht immer die Betreuung der Erkrankten verbessern, vor allem nicht, wenn der menschliche Zugang fehle.
„Vor zehn Jahren kam die Patientin oder der Patient mit einem einzigen A4-Zettel. Heute haben wir das Telefon, das uns närrisch macht. Wir haben Mails. Die Betroffenen kommen zu meiner privaten Telefonnummer. Wir haben die Befunde aus dem Medical Net, wir bekommen Mails, Fax-Nachrichten. Wir haben die Bewilligung der Medikamente, die E-Medikation. In Wahrheit fühle ich mich in einem Kanonenregen. Was mir fehlt: Ich bekomme Befunde, ohne die Patientin oder den Patient zu sehen“, sagte die Hausärztin.
Das führe dazu, dass die Patientinnen und Patienten nicht mehr in dem Ausmaß im persönlichen Kontakt betreut würden. „Die Diagnose und die Therapie fangen an, wenn ich die Türe zum Wartezimmer aufmache und sehe, wie die Patientin oder der Patient hereingeht“, sagte die Ärztin.
Gerade während der Covid-19-Pandemie hätte die Abwesenheit persönlicher Arzt-Patienten-Kontakte zum Beispiel bei Diabetikerinnen und Diabetikern zu vermeidbaren Folgeschäden geführt. Noch ein Faktum, wie die Ärztin feststellte: „Ich sitze fünf bis sechs Stunden in der Ordination. Aber ich habe dann noch bis zu vier Stunden Aufarbeitungszeit. Die Diagnose und die Therapie vor oder nach der Ordination, die wir da machen, ist aber ohne Bezahlung.“ Nicht einmal die Ambulatorien der Österreichischen Gesundheitskasse würden ihre Befunde in EDV-mäßig verwertbarer Form liefern. Die Hausärztin: „Es war schon gut, dass Covid-19 die Digitalisierung vorangetrieben hat. Aber die Zuwendungsmedizin sollte nicht zu kurz kommen.“
Ohne „Cloud“ wird es nicht gehen
„Es geht in Richtung Cloud“, sagte wiederum Dietmar Maierhofer, Business & Sales Manager Health Care Informatics (Philips). Viele Menschen seien sich noch nicht bewusst, wie weit sie in ihren EDV-Aktivitäten bereits in “wolkigen“ Systemen mit Plattform-Strategien oder gar beim Cloud Computing gelandet sind. Theoretisch unbegrenzte Skalierbarkeit, Agilität, ständige Verfügbarkeit sowie Bezahlung nach Nutzung seien einige der Vorteile dieser bedarfsgerechten Bereitstellung von IT-Ressosuren auf Abruf und mit Mietmodellen. Das gelte auch für den Bereich Gesundheit.
Freilich, gerade im Gesundheitswesen gibt es noch Vorbehalte auf Seite der Anwenderinnen und Anwender. Eine Umfrage in den DACH-Ländern über die Cloud-Nutzung im Gesundheitsbereich (Spitäler, Bildgebungsinstitute etc.) hat ergeben: 87% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen aktuell Cloud-Anwendungen ein. 69% aber verwenden sie ausschließlich in Verwaltung und Administration. „Der Großteil der Daten, insbesondere im Bereich medizinische und Patientendaten, werden on premise gespeichert“, sagte Maierhofer. Trotzdem würden sich diese Technologien längerfristig durchsetzen. „Wir werden das nicht verhindern. Wir werden auch Artificial Intelligence drin haben.“
Unterschiedliche Beziehungsformen prägen die Erwartungen an die Beziehungspartnerinnen und -partner. Es gibt kein One-size-fits-all.
Stefan Raff
Pro Monat werden 500.000 Tabletten in Blistern ausgeliefert.
Die Fehlerquote beträgt 0,04 %.Gunda Gittler
Ein Gesundheitstagebuch kann die Überlebenschancen von Onkologie -Patientinnen und -Patienten bewiesenermaßen erhöhen.
Reinhard Riedl
Robo-Berater nicht für jeden geeignet
Artificial Intelligence und Chat-Bots könnten in Zukunft einen Teil der Patienten-Arzt-Kommunikation übernehmen. Doch geeignet sind die Robo-Berater
wahrscheinlich nicht für alle Menschen gleichermaßen. Das haben Forschungen eines Teams um Dr. Stefan Raff (Fachhochschule Bern) ergeben. „Es gibt kein One-size-fits-all“, sagte Raf.
Die Wissenschafter nehmen Bezug auf die Charakteristika von Servicebeziehungen wie sie auch im Arzt-Patienten-Kontakt gegeben sind. „Unterschiedliche Beziehungsformen prägen die Erwartungen an die Beziehungspartnerinnen und -partner. Es gibt Menschen, die Austauschbeziehungen bevorzugen, die funktional, rational, unemotional sind und dem quid-pro-quo-Prinzip folgen“, stellte Raff dar. Auf der anderen Seite gibt es Menschen mit Bedürfnis nach gemeinschaftlichen Beziehungen (Empathie, sozial unterstützend, uneigennützig). Diese Personen wollen in ihren Ängsten und Sorgen ernst genommen und umsorgt werden.
Die Wisssenschafter testeten, wie Patientinnen und Patienten des Luisen-Krankenhauses in Aachen in Deutschland auf die Ankündigung der Abwicklung eines Muttermal-Checks via Handy und Robo-Berater statt persönlichem Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt reagierten. Es handelte sich um 106 Testpersonen. Fazit: Bei Menschen, die Austauschbeziehungen bevorzugten, kam der Service gut an. Doch Personen mit Präferenz einer gemeinschaftlichen Beziehung zeigten deutlich negative Reaktionen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Man sollte also abklären, welche Art der Versorgung der Einzelne bevorzuge, betonte der Experte. Außerdem könne man eventuell durch Möglichkeiten zu einer raschen persönlichen Kontaktaufnahme Skepsis überwinden helfen. Robo-Berater plus menschliches Back-up sei wahrscheinlich ein gangbarer Weg.
Digitalisierung als größter Mehrwert
„Wenn man Digitalisierung richtig betreibt, wird aus einer Raupe ein Schmetterling. Wenn man es nicht richtig macht, hat man bestenfalls eine schnellere Raupe“, zitiert LEAD Horizon Prokuristin Angela Hengsberger den MIT-Guru George Westerman. Dem entsprechend sei es bei der Umsetzung von “Alles gurgelt“ mit den Covid-19-PCR-Tests in Wien eben um die möglichst optimale und kundennahe Umsetzung digitaler Technologien gegangen.
„Der große Mehrwert steckt in der digitalen Komponente”, sagte Hengsberger. Die Userin bzw. der User sollte eben in die Lage versetzt werden, die wichtigsten Daten bereitzustellen und zu übermitteln. Auf digitalem Weg sollte er dann das Ergebnis des Tests erhalten. Das sei gelungen. Anders wäre es auch gar nicht möglich gewesen, in Wien bis zu eine Million Benutzerinnen und Benutzer pro Woche bei bis zu 600.000 Tests pro Tag zu bedienen. Man werde diesen Weg auch bei anderen Gesundheitsservices in Zukunft weitergehen.
Es geht in Richtung Cloud. Patientendaten werden noch vorwiegend on premise gespeichert.
Dietmar Maierhofer
OP-Komplikationen frühzeitig erkennen
Das Mortalitätsrisiko infolge einer Anästhesie bei einer Operation beträgt 1 zu 200.000. Das spricht für höchste Sicherheit. Doch rund um Operationen wären Verbesserungen durchaus noch möglich. „Weltweit erfolgen pro Jahr 77 Millionen Operationen. 25 Prozent der Patientinnen und Patienten haben danach postoperative Komplikationen. 12 % der Spitalsmortalität ist auf solche Komplikationen zurückzuführen“, sagte Univ.-Prof. Dr. Oliver Kimberger (MedUni Wien).
Das Problem liegt laut wissenschaftlichen Untersuchungen weniger in der Zahl der Komplikationen, sondern darin, dass sie oft nicht frühzeitig genug oder gar nicht bemerkt würden. „Es ist ein Versagen beim Retten der Patientinnen und Patienten“, erklärte Kimberger. Auch hier könnten digitale Überwachungssysteme helfen. Durch Verbesserung der perioperativen Prozesse könnte die Sicherheit weiter gesteigert werden. Ein Aspekt, so der Experte: „Im Operationssaal und auf der Intensivstation werden die Patientinnen und Patienten unglaublich engmaschig monitiert. Doch mit der Übersiedlung auf die Bettenstation
kommt eine große Monitoring-Lücke.“ Hier könnten bessere digitale und tragbare Systeme helfen. Ein anderes Beispiel: Eine digitalisierte Prä-Hospitalanamnese, elektronische Checklisten oder die Erhebung weniger aussagekräftiger Parameter über den Zustand der Patientinnen und Patienten könnten wiederum zu einer besseren Risikoeinschätzung führen. Wer vor einer Operation täglich mehr als 7.500 Schritte pro Tag geht, hat nur ein Viertel des Komplikationsrisiko einer immobilen Vergleichsperson. Einfache tragbare Fitness-Schrittzähler könnten darauf hinweisen und sogar zu mehr Mobilität motivieren.
Wie man ein Gesundheitsportal auswählt
In Niederösterreich ist die Landesgesundheitsagentur dabei, digitale Patienten- bzw. Zuweiserportale bezüglich Landeskrankenanstalten zu etablieren. Das soll den möglichst automatisierten Informationsaustausch zwischen Patientinnen und Patienten und Gesundheitswesen, Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern sowie Rettungswesen ermöglichen. Die Frage ist, welche Provider man am besten auswählt. Ing. Wolfgang Grim (NÖ LGA) nannte hier vier Hauptfaktoren: Time-to-Market, Interoperabilität, intuitive Bedienung und Partnerschaft, was die Verlässlichkeit bei Lieferung und Weiterentwicklung betrifft. So sollten solche Portale für Patientinnen und Patienten und Zuweiserinnen und Zuweiser am besten bestehende Primärsysteme ergänzen. Die Lieferanten müssten aber auch die notwendigen Kapazitäten in der Leistungserbringung besitzen. Zusätzliche Datentöpfe seien zu vermeiden. Und schließlich sollte der Fokus des Herstellers auf dem jeweiligen Produkt mit Interesse an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung liegen.
Abonnieren Sie PERISKOP gleich online und lesen Sie alle Artikel in voller Länge.