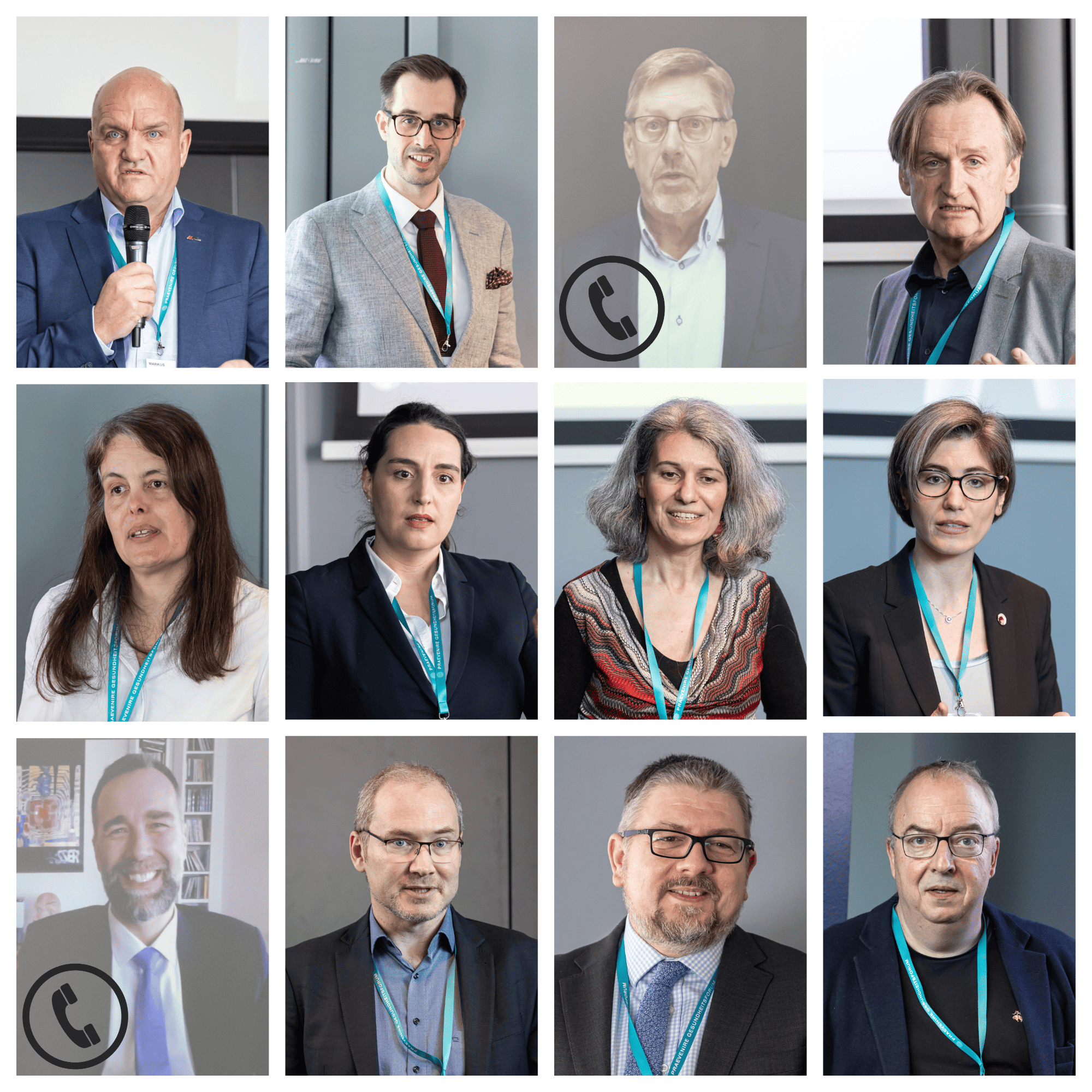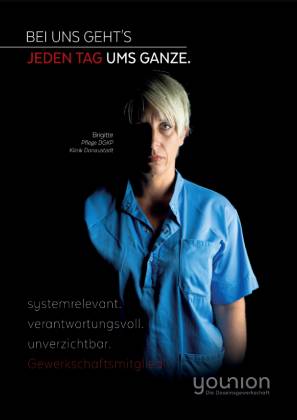Nach der starken und kritischen Keynote von AK NÖ-Präsident Markus Wieser ging es am zweiten Tag des 5. PRAEVENIRE Digital Health Symposions am 21. April um das Thema „KI in der medizinischen Versorgung – durch Qualitätsmanagement zur Erfüllung ethische Ansprüche“.

Mag. Dora Skamperls
PERISKOP-Redakteurin
Seine Keynote mit dem Titel „Bedeutung der Versorgungssicherheit in der Gesundheit – digitale Lösungen sind unerlässlich“ begann Markus Wieser mit der Frage: „Warum spricht hier ein Interessensvertreter?“, – und gab eine klare Antwort: „Alles, was entschieden wird, ob es um Gesundheit, Versorgungssicherheit, um Technologien geht, es geht immer um Menschen, es geht um uns. Und es sind immerhin vier Millionen Menschen in Österreich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.“
Die drei V für Österreich
Schon einige Zeit vor der Pandemie habe die AK ein Memorandum zur Versorgungssicherheit präsentiert, das damals wenig Beachtung fand. Darin habe man die drei V für Österreich formuliert: Veränderung in der Arbeitswelt, Verteilungsgerechtigkeit und Versorgungssicherheit, v.a. im Bereich der Daseinsversorger bzw. kritischen Infrastruktur. Hier könnten funktionierende IT-Lösungen, KI und Robotik viel zur Entlastung beitragen.
Praktischer Nutzen der KI
Das Fachthema 3 „KI in der medizinischen Versorgung – durch Qualitätsmanagement zur Erfüllung ethische Ansprüche“ begann mit spannenden Fachbeiträgen zum praktischen Nutzen der KI. Der PRAEVENIRE Experte und Allgemeinmediziner Dr. Erwin Rebhandl ließ mit seinem Vortrag zum praktischen Nutzen von KI im aktuellen medizinischen Alltag aufhorchen. Rebhandl stellte dar, dass KI und digitale Hilfsmittel schon heute die tägliche Arbeit in der Allgemeinmedizin erleichtern.
Ein wichtiges Tool sei bspw. die Warnung vor schweren Medikamenteninteraktionen, was ins- besondere bei multimorbiden Patientinnen und Patienten mit Polymedikation wichtig sei. Auch bei Befundinterpretationen, wie EKG, Pyrometrie, Langzeit-Blutdruckmessung etc. werde die KI bereits eingesetzt. Die Interpretation im Kontext mit dem klinischen Zustandsbild der Patientin bzw. des Patienten sei jedoch Sache der Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner. Auch könnten eine Videokonsultation und Apps nie den persönlichen Kontakt ersetzen, sondern lediglich eine Ergänzung sein.
Patient Twinning als Tool für Präzisionstherapien
Der zweite Fachvortrag von Peter Aulbach (Siemens Healthineers) mit dem Titel „Digital Twins aus Sicht der Patient: innen: In welchen Bereichen können Sie von Digital Twins profitieren?“ fokussierte auf Hintergründe und entscheidende Faktoren für die Anwendung solcher Systeme. Siemens Healthineers stellt sich im Rahmen seines New-Ambition-Projekts noch stärker klinisch auf und konzentriert sich dabei auf drei Bereiche: Patient Twinning, Digital, Data und AI sowie Precision Therapy. Patient Twinning werde als Technologie genutzt, um basierend auf Daten, die mithilfe von KI ausgewertet werden, Informationen zum Nutzen der Patientinnen und Patienten zu gewinnen und letztlich damit Precision Therapy zu ermöglichen. Die Umsetzung dieser hypothetischen Vision ruht wiederum auf drei technischen Pfeilern. Passende Daten aus sämtlichen Technologien der Sensorik inkl. Bildgebung ermöglichen es, ein cyberphysikalisches Modell des einzelnen Patienten bzw. der einzelnen Patientin abzubilden. Dies mit dem Ziel, diese einer KI zur Verfügung zu stellen, die daraus Rückschlüsse zieht – sogenannte „aktionierbare Insights“. Einerseits können damit Assistenzsysteme serviciert werden und sogenannte Co-Bot-Systeme entwickelt werden, die teilautomatisch funktionieren. Die schnelle, nachhaltige und nach ethischen Gesichtspunkten orientierte Entwicklung von KI-Systemen sei eine Kernkompetenz von Siemens Healthineers, erklärte Aulbach.
Alles, was entschieden wird, ob es um Gesundheit, Versorgungssicherheit, um Technologien geht, es geht immer um Menschen, es geht um uns.
Markus Wieser
Digital Twins als Servicemodule
Zum Thema „Digital Twins aus Sicht der Gesundheitspraxis: Wie können sie praktisch genutzt werden?“ referierte Prof. Dr. Juliana Bowles, Professorin in Computer Science an der University of St Andrews, UK, und Research Managerin am Software Competence Center Hagenberg, Österreich. Sie führte aus, dass Digitale Zwillinge grundsätzlich für alles erstellt werden können, nicht nur für Menschen – seien es technische Geräte oder auch Prozesse. Sie wurden ursprünglich für die Luftfahrt entwickelt und werden bis heute viel für die Simulation von Produktionsprozessen genutzt. Ein massives Hindernis für die Erstellung guter Digital Twins im klinischen Bereich, zum Beispiel in der Onkologie, seien auch in Österreich die vielen unterschiedlichen Systeme, in denen die Daten abgelegt seien. Diese kommunizieren nicht und daher sei es sehr aufwendig, Digital Twins zu erstellen. Bowles selbst sieht Digital Twins als erstklassige Servicemodule, die viel Unterstützung bieten können, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass nur eine hohe Datenqualität ihre Vertrauenswürdigkeit sicherstellen kann.
Forschung voranbringen mit Digital Twins
Dr. Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien, Leiter Health Economics & Health Policy, lieferte einen Einblick in die Sozioöko- nomie von KI-Modellen mit dem Titel „Socioeconomic impact of in-silico models for the development of implantable devices“. Sein Institut betreibe angewandte Forschung, die auch für die Politik relevant sei, führte Czypionka einleitend aus. Er stellte exemplarisch das Projekt SIMCor vor, das schon weit gediehen ist. SIMCor beschäftigt sich mit cardiovaskulären implantierbaren Medical Devices. In-silico-Tests mithilfe von Digital Twins werden bisher vor allem in der präklinischen Designphase solcher Medical Devices verwendet. Digitale Prototypen können so getestet, angepasst und wieder getestet werden, was weniger kostenintensiv ist. Ein Teil der Tierversuche kann auf diese Weise ersetzt werden. Im IHS werden auch die Folgen und Effekte solcher digitalen Versuchsreihen für das Produkt selbst, Produktionsprozesse, den Markt, das Gesundheitswesen und die Gesellschaft etc. untersucht.
Die COVID-19-Pandemie war ein Turbo für den Einsatz digitaler Tools.
Erwin Rebhandl
Soziale Aspekte berücksichtigen
Zum Thema „KI aus Sicht der Patient:innen: Wie vertrauenswürdig und wie fair ist die Nutzung von KI?“ referierte zunächst Prof. (FH) Mona Dür PhD, MSc, Geschäftsführe- rin Duervation GmbH und Präsidentin der Austrian Association of Occupational Science (AOS). Duervation konzentriert sich auf die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender von KI-Systemen. Transparenz in der Kommu- nikation aller Prozesse und der Anwendung von Daten sei oberstes Gebot, um die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen sicherzustellen. Auch gelte es, Barrierefreiheit herzustellen und Diskriminierung entgegenzuarbeiten. Bei Anfragen an die KI, die bspw. Kosten-Nutzen-Analysen betreffen, seien soziale Aspekte zu berücksichtigen, um Fairness zu gewährleisten. Auch vonseiten des Gesundheitspersonals seien die wichtigsten Anliegen, sicherzustellen, dass KI-Anwendungen evidenzbasiert und transparent arbeiten sowie diese der Unterstützung der Menschen dienen, diese aber nicht ersetzen. Auch der Europäische Gesundheitsdatenraum werde in diese Richtung orientieren, konstatierte Dür abschließend.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Univ.-Ass. Dr. Žiga Škorjanc, Universitätsassistent und Habilitand am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien und Geschäftsführer der lexICT, ließ in seiner Keynote über Technologierecht keinen Zweifel daran, dass Vertrauen auch im rechtlichen Bereich Grundlage für die Gesetzgebung sein muss. Menschen misstrauen der KI als Technologie, auch im Gesundheitswesen. Durch den AI-Act auf EU-Ebene werden wohl neue Pflichten bez. der Aufklärung auf den Gesund- heitsbereich zukommen. Er stellt klar, dass bei interagierenden Systemen wie ChatGPT eine Transparenzpflicht bei Weitem nicht ausreichend sein wird, um die Risiken zu minimieren. Eine Verrechtlichung ethischer Grundsätze sei not- wendig, um sich nicht in Grauzonen zu bewegen – die beiden wichtigsten sind: Die letzte Entscheidung muss immer beim Menschen liegen, die Patientinnen und Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, welche Prozesse der KI angewendet werden.
Die KI hat fantastisches Potenzial, wenn sie den Ärztinnen und Ärzten die Dokumentationslast abnehmen kann.
Michael Gnant
Trial and Error
Rania Wazir, PhD Expertin für Data Science & AI und Co-Gründerin von leiwand.ai, zeigte auf, dass wir längst nicht mehr raten müssen, wo sich KI in die falsche Richtung entwickelt. Die Fehler liegen bei den Menschen, die KI-Systeme mit Daten versorgen – so würden selbst gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierung systemisiert. Weiter würde jedes einzelne KI-System mehr CO2 verbrauchen als drei Autos in ihrem Lebenszyklus. Trotz dieser Problematiken könne KI vor allem im Gesund-heitswesen viel Gutes bewirken. Wichtig seien die Einbindung aller Stakeholder in die Entwicklung solcher Systeme, Transparenz in der Fehlerkultur und – „testen, testen, testen“.
Klarer Mehrwert und Datensouveränität
Im zweiten Block „KI aus Sicht der Gesundheitsfachpersonen: Wie zuverlässig ist die KI?“ startete Univ.-Prof. Dr. Allan Hanbury, Professor for Data Intelligence, head of the E-Commerce Research Unit, and Vice Dean of Academic Affairs for Business Informatics in the Faculty of Informatics an der TU Wien mit seiner Keynote zum Thema „Zuverlässige KI in der Radiologie“.
Vor dem Hintergrund sinkender Zahlen an Radiologinnen und Radiologen mit gleichzeitig wesentlich komplexer werdender Befundung könne KI viel an Unterstützung leisten. Ein klarer Mehrwert und Datensouveränität müssen aber gewährleistet sein.
Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant, Leiter des Comprehensive Cancer Center an der Medizinischen Universität Wien, stellte fest, dass es in den Krankenhäusern bereits jetzt viele Einsatzgebiete für die KI gebe, u.a. Diagnostikverbesserung, Beschleunigung der Prozesse, Imageanalyse, Unterstützung bei der Patientenaufklärung und -kommunikation, Unterstützung bei Therapieentscheidungen. Bei der Entlastung des Personals in der Dokumentation, Visualisierung und Aufbereitung gebe es noch viel Potenzial, so Gnant. Er stellte klar, dass mittlerweile – ohne, dass die Zustimmung von Patientinnen und Patienten notwendig sei –, längst in vielen medizinischen Bereichen mit KI gearbeitet werde.
Bei der Datenqualität gilt der Grundsatz: garbage in – garbage out.
Peter Aulbach
Gigantische Datenmengen
Der Block „Aktuelle Forschung“ startete mit dem Thema „KI in der Bildgebung des Bewegungsapparates“. Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, Dekan der Fakultät Gesundheit und Medizin an der Universität für Weiterbildung Krems und Professor für Tissue Engineering, begann seine Keynote mit der Frage: „Wie kommt ein Orthopäde zur Artificial Intelligence?“ Die individuelle Interpretation von Bildgebung sei mit KI standardisierbar, so Nehrer – doch gebe es viele Parameter, die zu beachten seien. Der Vergleich der Outcomes zeige, dass die Nutzung von KI in der Interpretation orthopädischer Bilddaten und die daraus folgende raschere und genauere Diagnose und Behandlung den herkömmlichen Methoden überlegen seien.
DI Dr. Roxane Licandro, BSc vom Computational Imaging Research Lab; Department of Biomedical Imaging and Imageguided Therapy der Medizinischen Universität Wien schloss mit Ihrer Keynote zum Thema „Resultate der Grundlagenforschung“ an. „Wir haben in unserem Gehirn genauso viele Neurone wie Sterne in der Galaxie“, begann sie – womit klar ist, dass KI den Menschen nie „ersetzen“ kann. Wir stehen in der Hirnforschung noch ganz am Anfang, auch technologisch, stellte Licandro klar.
Dennoch sei KI bereits jetzt ein gutes Hilfsmittel, um Forschung zu betreiben. Anhand des Praxisbeispiels von MR-Bildgebung bei Föten werden die Herausforderungen klar, denn ein Fötus bewegt sich während der Aufnahmen. Algorithmen rechnen aus unzähligen Bildern die Bewegungsartefakte heraus und liefern stabile Bilder. Derzeit werde etwa am Plötzlichen Kindstod geforscht, aber KI werde auch im Bereich der Segmentierung von Organen oder der automatischen Klassifizierung verschiedener Zelltypen eingesetzt.
Abonnieren Sie PERISKOP gleich online und lesen Sie alle Artikel in voller Länge.