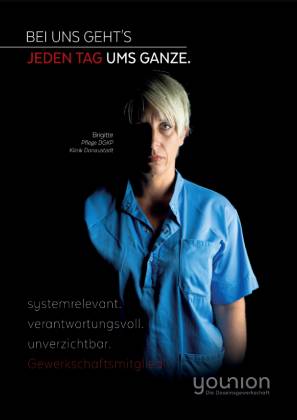die Integration von Ernährung(-stherapie) in den medizinischen Alltag ist ein strategisches Gesundheitsthema, das dringend mehr Aufmerksamkeit der Politik erfordert. Denn gerade bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zeigt sich, dass die Ernährung nicht nur die Entstehung von Krankheiten, sondern auch den Therapieerfolg beeinflussen kann. | von Paul Schnell
Lange Zeit wurde das Thema Ernährung in der Medizin als Randthema betrachtet, allenfalls als eine gute Ergänzung, aber bei Weitem nicht als ein integraler Bestandteil von Prävention, Krankheitsentstehung oder Therapieverlauf. Doch die wissenschaftliche Evidenz wächst und macht deutlich, dass die Ernährung den Stoffwechsel maßgeblich mitbestimmt. Das beeinflusst unter anderem, wie wir altern und welche Krankheiten sich entwickeln. Relativ neu sind die Ergebnisse von Studien, die nahelegen, dass Ernährung und Stoffwechsel auch moderne Ernährungsformen beeinflussen können.
In einer Gesellschaft, die einerseits älter wird und andererseits zunehmend mit Übergewicht, Fehlernährung und Bewegungsmangel konfrontiert ist, rückt das Thema Ernährung daher ins Zentrum der klinischen Praxis und der gesundheitspolitischen Agenda.
Eine besondere Herausforderung ist die sogenannte „mangelhafte Hyperalimentation“: eine Ernährung, die einerseits reich an Zucker, Fett und hochverarbeiteten Lebensmitteln ist, gleichzeitig aber arm an essenziellen Nährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Dies führt zu einer paradoxen Situation: Die Energiezufuhr ist hoch, die ernährungsphysiologische Qualität hingegen zu gering. Und genau dieses Muster ist längst kein Randphänomen mehr, sondern prägt das Essverhalten großer Teile der Bevölkerung. Dass es auch für viele neue Patientinnen und Patienten in den kommenden Jahren sorgen wird, weiß auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Felix Keil. Der Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämato-Onkologie, Intensivmedizin und Leiter der 3. Medizinischen Abteilung im Wiener Hanusch-Krankenhaus der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) beschreibt im Gespräch mit PRAEVENIRE, warum die Ernährung bei Stoffwechselerkrankungen, aber auch in der Onkologie eine derzeit noch unterschätzte Ressource ist. Er ist sowohl kooptiertes Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (ÖGHO) als auch Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Klinische Ernährung (AKE) und setzt sich in diesen Funktionen interdisziplinär für die Verbesserung des Allgemeinzustandes und die Beschleunigung des Genesungsprozesses von Kranken durch professionelle klinische Ernährung ein.
Periskop: Wie hängt eine ausgewogene Ernährung mit der Entwicklung von Demografie und Krankheitslast zusammen?
Keil: Die demographische Entwicklung zeigt zwei Dinge, die uns in der Versorgung generell beschäftigen werden. Einerseits sehen wir eine seit 1970 ansteigende Adipositasrate in unserer Gesellschaft. Andererseits werden wir durch die Erfolge in der Medizin und den in die Jahre kommenden Babyboomern eine Verdoppelung der über 80-Jährigen in Österreich bis 2040 beobachten. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit von Erkrankungen, die wiederum mit Ernährung und Lebensstil verknüpft sind. Neben Diabetes mellitus, kardiovaskulären Erkrankungen oder Adipositas sind Alter und Übergewicht kombiniert mit Fehlernährung auch für die Zunahme der Tumorerkrankungen verantwortlich. Speziell das Bauchfett ist bei Adipösen nicht nur ein Energiespeicher, sondern ein aktives Gewebe, das unter anderem chronische Entzündungsprozesse befeuert und die Onkogenese stimuliert. Diese systemischen Prozesse erhöhen das Risiko, gewisse maligne Erkrankungen zu entwickeln, und verschlechtern wiederum die Erfolgsaussichten einiger onkologischer Therapien.
In Österreich sind knapp 20 Prozent der Erwachsenen krankhaft übergewichtig mit einem Body-Mass-Index über 30 und 35 Prozent übergewichtig mit Body-Mass-Index über 25. Besorgniserregend ist zudem, dass ein Viertel der Kinder bereits übergewichtig ist und junge Erwachsenen bereits eine nicht-alkoholische Fettleber unterschiedlicher Schweregrade aufweisen. Diese Erkrankung, die eng mit Übergewicht und übermäßiger Zuckeraufnahme in verarbeiteten Lebensmitteln verbunden ist, galt lange Zeit als Problem älterer Bevölkerungsgruppen. Eine Fettleber wiederum erhöht deutlich die Toxizität mancher hämato-onkologischer Therapien. Relativ rezent sind Erkenntnisse, dass Fettleibigkeit und chronische Entzündungen auch Mutationen in blutbildenden Stammzellen verursachen können, die wiederum Entzündungen und Gefäßerkrankungen oder die Tumorentstehungen fördern.
Gibt es ausreichend Evidenz zur Relevanz von Ernährung im therapeutischen Kontext?
Der Nutzen gesunder Ernährung in der Prävention ist nicht zu bestreiten, und die Evidenz deren Benefit bei Adipositas oder Diabetes ist klar. Bezüglich der Interaktion moderner Therapien und Ernährung sowie Lebensstil ist der Zusammenhang komplexer. Wir wissen natürlich, wie erwähnt, dass Dauer und Ausmaß der Fettleibigkeit Risikofaktoren für Tumorerkrankung sind. Schwieriger ist die Frage, wie eine gezielte Ernährung einen Krankheitsverlauf bei Tumorpatientinnen und -patienten in der Therapie beeinflussen kann. Jedenfalls muss bei den Erkrankten ein funktioneller Ernährungsstatus erhoben werden, um bei beginnender Mangelernährung – ungewolltem Gewichtsverlust und/oder verringerter Nahrungsaufnahme – mit einhergehender Funktionseinschränkung frühzeitig intervenieren zu können. Mangelernährung kann übrigens auch Menschen mit Übergewicht oder mit Fettleibigkeit betreffen – auch bei ihnen muss bei ungewolltem Gewichtsverlust interveniert werden. Es zeigt sich, dass Patientinnen und Patienten mit einem guten Ernährungs- und Stoffwechselstatus besser auf einige Therapien ansprechen beziehungsweise diese besser tolerieren, weniger Nebenwirkungen haben und insgesamt höhere Überlebenschancen besitzen.
Studien zeigen, dass gezielte Ernährungsberatung im häuslichen Umfeld oft nachhaltiger wirkt als aufwendige Supplementierungen. Patientinnen und Patienten, die darin unterstützt werden, welche Lebensmittel sie einkaufen, wie sie kochen und welche Ernährungsweise sich in ihren Alltag integrieren lässt, profitieren langfristig mehr als von kurzfristigen, spitalszentrierten Interventionen. Die Verfügbarkeit von spezifischer Ernährungsunterstützung wie Trink- oder Sondennahrung sollte bei Evidenz und Bedarf sichergestellt werden. Generell sind Studien bezüglich Einfluss von Lebensstilinterventionen und Verbesserung modernen Therapien sehr interessant und zeigen positive Resultate. Wie wir mit Ernährungskonzepten eine bestehende Erkrankung modifizieren können, muss einzelnen von Erkrankung und Therapiemöglichkeiten differenziert beurteilt werden. Die Intervention bezüglich Ernährung, Bewegung und auch Rehabilitation und Prähabilitation ist im Vergleich zum sonstigen Aufwand in der Gesundheitsversorgung eher günstig und frühzeitig angewendet auch effizient. Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten zum Beispiel vor Stammzelltransplantation ein gezieltes Ernährungs- und Bewegungsprogramm an, klinisch sinnvoll, aber eben nicht in Studien untersucht. Gerade diese Studien, die etablierte Therapien effizienter machen könnten, müssten von der öffentlichen Hand oder akademischen Institutionen finanziert und durchgeführt werden. Wir haben erfreulicherweise genügend Entwicklungen bei modernen medikamentösen Therapien, die ausreichend von der Industrie finanziert werden, aber es sollten eben auch akademische Studien mit oben genannten Themen im Interesse einer verbesserten Patientenversorgung finanziert werden. Zumal Alter, Funktionszustand mit Ernährung sowie Komorbiditäten eben ganz entscheidende beeinflussende Faktoren bei jeder Art von Therapien sind.
Facts & Figures
Die Arbeitsgemeinschaft für Klinische Ernährung (AKE) wurde 1979 gegründet und ist international anerkannter Partner im therapeutischen und wissenschaftlichen Bereich. Rund 800 Mitglieder aus allen Berufsgruppen, die sich mit klinischer Ernährung beschäftigen, haben sich zum Ziel gesetzt, die therapeutische und wissenschaftliche Bedeutung dieser Disziplin in Österreich sowie den Austausch und die Verbreitung von Erkenntnissen zu fördern. Damit soll die Bedeutung der Verbesserung des Allgemeinzustandes und Beschleunigung des Genesungsprozesses von Kranken durch professionelle klinische Ernährung mehr Öffentlichkeit erhalten. Als zentrale Ansprechpartnerin für die Organisation und Koordination der AKE fungiert Geschäftsführerin Alexandra Schweiger, BSc. Sie stellt die Kooperation mit Gesundheitsträgern und medizinischen Fachgesellschaften her, leitet das Veranstaltungsmanagement sowie die Medien- & Öffentlichkeitsarbeit
Müssten diese Fragen nicht interdisziplinär und multiprofessionell bearbeitet werden?
Selbstverständlich! Langsam spiegelt sich die Notwendigkeit, Ernährung stärker in die Medizin zu integrieren, auch in der Kongresslandschaft wider. Veranstaltungen wie jene des Arbeitskreises Klinische Ernährung (AKE) bringen Expertinnen und Experten aus Medizin, Pflege, der Diätologie, der Ernährungswissenschaft und der Forschung zusammen. Dabei geht es zum Beispiel um Fragen, welche Rolle Ernährung bei der Entstehung von Tumoren spielt, wie das Immunsystem durch gezielte Ernährung gestärkt werden kann oder wie sich eine durchgängige Versorgung zwischen Spital und extramuralem Bereich sicherstellen lässt. Besonders bemerkenswert ist, dass solche Diskussionen inzwischen auch in Kooperation mit anderen medizinischen Fachgesellschaften, die vielleicht früher die Ernährung nicht so im Fokus hatten, geführt werden. Dies zeigt, dass Ernährung aus der Nische in den Mainstream der klinischen Medizin rückt und wir werden diese Themen auch breit in unserer Herbsttagung der AKE interdisziplinär diskutieren.
Kann eine ausgewogene Ernährung auch das Immunsystem positiv beeinflussen?
Ein wesentlicher pathophysiologischer Mechanismus, der die Relevanz der Ernährung unterstreicht, ist die oben beschriebene chronische Inflammation durch ungesunde Ernährung, die auch das spezifische Immunsystem schwächen kann. Adipositas geht mit einer permanenten Reizung und eventuell Erschöpfung des Immunsystems einher und beeinflusst das Mikrobiom negativ. Die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm beeinflusst Immunprozesse, entzündliche Reaktionen und Stoffwechselvorgänge. Eine hohe Diversität des Mikrobioms geht mit einer besseren Ansprechrate von Immuntherapien einher. Eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen, fermentierten Lebensmitteln und unverarbeiteten Produkten ist. Eine gezielte Ernährungsumstellung kann die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern. Sie fördert die Diversität des Mikrobioms und kann somit die Grundlage für ein verbessertes Therapieansprechen schaffen – und das bei geringen Kosten und ohne relevante Nebenwirkungen. Der Darm ist letzten Endes auch ein Immunorgan mit einer Fläche von 40m2. So konnte in Studien die Wirksamkeit und Toxizität in der Stammzelltransplantation oder bei immunonkologischen Therapien durch nicht resorbierbare resistente Stärke positiv beeinflusst werden. Resistente Stärke können Sie im Alltag ganz einfach herstellen, Erdäpfel kochen, schnell abkühlen und nach 24 Stunden Kühlzeit zum Kochen verwenden.
Diese beeinflusst das Mikrobiom und damit die immunologischen Reaktionen günstig. Somit könnten moderne onkologische Behandlungen, darunter Immun- und Zelltherapien, durch die Leistungsfähigkeit des Immunsystems des behandelten Patienten beeinflusst werden. Diese Studien sind schlüssig und überzeugen mich als Hämato-Onkologen, allgemeinen Internisten, Intensivmediziner und Stammzelltransplanteur und metabolisch interessierten Arzt gleichermaßen. Aber wir brauchen dennoch bestätigende Studien.
Braucht es mehr Bewusstsein, etwa auch in der Gesundheitspolitik, für die Rolle von Ernährung und Therapieerfolg und wie kann eine erfolgreiche Umsetzung aussehen?
Wir müssen immer die Rolle der Ernährung in der Prävention einerseits und bei der Verbesserung therapeutischer Ergebnisse andererseits unterscheiden. Die Rolle der Prävention ist leicht zu beantworten. Wie gesunde Ernährung systematisch gefördert werden kann, wird längst nicht mehr nur von Ärztinnen, Ärzten und Forschenden diskutiert, sondern ist auch ein gesundheitspolitisches Thema. Initiativen wie die EAT-Lancet-Kommission oder die „Planetary Health Diet“ plädieren für eine Ernährung, die sowohl die menschliche Gesundheit schützt als auch ökologisch nachhaltig ist. Das Konzept sieht vor, regionale, saisonale und pflanzenbasierte Lebensmittel stärker zu fördern, während hochverarbeitete Produkte, rotes Fleisch und zuckerreiche Nahrungsmittel reduziert werden. Essen ist ja auch mit Kultur, sozialem Wohlbefinden und Genuss verbunden und der kann eben auch gesund sein. Eine simple Regel wäre der Verzicht auf Fertigprodukte und Süßgetränke sowie die Förderung der Freude am Kochen mit etwa 500 Gramm Gemüse und Obst pro Tag. Ein wirksames Instrument könnten wirtschaftliche Anreize sein: Subventionen für gesunde und lokal produzierte Lebensmittel und Steuermechanismen für ungesunde Produkte, ähnlich wie bei Tabak oder Alkohol. Österreich steht hier noch am Anfang, doch die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass finanzielle Anreize einen deutlichen Einfluss auf Konsumgewohnheiten haben können.
Eine mangelhafte Überernährung durch Angebote der Lebensmittelindustrie, die bereits bei Kindern beginnt, wird zu einer deutlichen Zunahme chronischer Erkrankungen führen. Während der unmittelbare finanzielle Gewinn bei der Lebensmittelindustrie bleibt, werden die individuellen Folgen und Kosten durch die zunehmenden Erkrankungen die Betroffenen und die Allgemeinheit zu tragen haben.
Das fragmentierte Gesundheitswesen in Österreich ist für so manche Versorgungslücken und fehlgeleiteten Ressourcen verantwortlich. Gilt das auch in Bezug auf die Ernährung?
Ein bekanntes Problem ist die Trennung von intra- und extramuraler Versorgung. Im Krankenhaus erhalten Patientinnen und Patienten häufig eine individuell angepasste Ernährung, begleitet von Diätologinnen und Diätologen sowie medizinischen Fachkräften. Nach der Entlassung aus dem Spital gilt es, die weitere Versorgung zu sichern. Manche sind im Alltag mit der Umsetzung der nötigen der Krankheit angepassten Ernährung überfordert, sei es aus finanziellen, sozialen oder praktischen Gründen. Im extramuralen Setting gibt es die Strukturen nicht immer, um diese Menschen adäquat weiter zu versorgen.
Das bedeutet, dass eine durchgängige Ernährungsversorgung, die den Übergang vom Krankenhaus in den Alltag sicherstellt, essenziell ist. Dazu braucht es strukturierte Programme, eine stärkere Einbindung von Ernährungsberatungen in die Regelversorgung und eine klare geregelte Transition von stationären in ambulante Strukturen.
Diäten und Ernährungsumstellungen sind meist in der Kommunikation nicht positiv besetzt. Verzicht, Einschränkung und mühsam sind der Grundtenor. Müsste das verändert werden?
Ernährungskonzepte dürfen nicht als freudlose Einschränkung verstanden werden. Ziel ist es, Genuss, Lebensqualität und Gesundheit in Einklang zu bringen. Es ist ja eigentlich skurril, dass die Ernährung, welche im Alltag in der kulturell, gesellschaftlich und kulinarisch so prominent besetzt ist, im klinischen Alltag eher das Aschenputtel der Versorgung zu sein scheint.
Eine saisonale, regionale und abwechslungsreiche Ernährung kann nicht nur Krankheiten vorbeugen, sondern auch Freude bereiten – vielleicht auch im Krankenhaus. Und sie ist nicht automatisch mit höheren Kosten verbunden, auch das gehört kommuniziert. Wer regional und saisonal einkauft, fährt meist billiger als mit dem Kauf hochverarbeiteter Convenience-Produkte. Damit Ernährungsempfehlungen angenommen werden, müssen sie realistisch, alltagstauglich und nicht dogmatisch formuliert sein und eben auch schmecken. Da haben wir sicher noch etwas Luft nach oben.
Und wie hoffentlich verständlich dargelegt, ist Ernährung eben auch ein zentraler Faktor für das Funktionieren des Immunsystems, für die Prävention chronischer Erkrankungen und könnte den Erfolg medizinischer Interventionen verbessern.