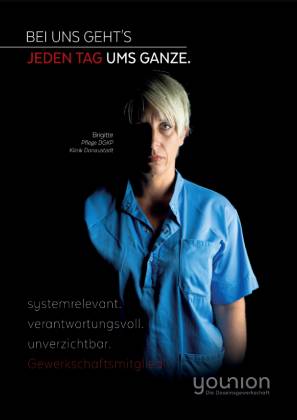Kardiovaskuläre Erkrankungen zählen nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen in Europa. Die Prävalenz steigt, die Risikofaktoren sind bekannt, doch es fehlt an systematischer Prävention, strukturiertem Risikomanagement und patientenorientierter Aufklärung. Mögliche Lösungsstrategien präsentiert Priv.-Doz. Dr. Georg Delle Karth, Past-Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft und Vorstand der Abteilung für Kardiologie an der Klinik Floridsdorf, in seinem Impulsvortrag beim PRAEVENIRE Denkertag. | von Mag. Renate Haiden, MSc.
Der Kardiologe plädiert deutlich für einen Paradigmenwechsel: „Prävention muss früher, konsequenter und breiter gedacht werden. Es braucht klare Zielwerte, digitale Hilfsmittel und das Empowerment von Patientinnen und Patienten.“ Denn nach Angaben des European Heart Journal sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 34 Prozent nach wie vor die häufigste Todesursache in den EU-27. Auch in Österreich liegt der Anteil mit 31 bis 37 Prozent über dem europäischen Durchschnitt. Besonders besorgniserregend ist für Delle Karth, dass die kardiovaskuläre Mortalität nur die Spitze des Eisbergs darstellt: „Noch mehr Gewicht haben die damit verbundenen Einschränkungen der Lebensqualität, insbesondere in höheren Lebensjahren.“ Frauen sind davon ebenso betroffen wie Männer, teils sogar noch stärker, denn durch die höhere Lebenserwartung tragen sie ein besonders hohes Risiko, mehr Lebensjahre in schlechter Gesundheit zu verbringen.
Facetten einer komplexen Erkrankung
„Das chronische Koronarsyndrom (CCS) ist eine Manifestationsform der koronaren Herzkrankheit mit vielfältigen Verlaufsformen und konstanter oder langsam progredienter Symptomatik. Während die einen ein stabiles, symptomfreies Leben führen, zeigen andere einen hochproblematischen Verlauf mit massiver Einschränkung der Lebensqualität. Die Erkrankung verläuft in der Regel chronisch, beginnt meist unbemerkt und wird erst spät klinisch manifest“, beschreibt Delle Karth. Die bekannten Risikofaktoren sind Rauchen, körperliche Inaktivität, Hypertonie, Dyslipidämie und Diabetes mellitus. „Das Ziel der Primärprävention muss daher sein, diese Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und zu kontrollieren, um sowohl klinische Ereignisse wie Myokardinfarkt und Schlaganfall zu verhindern als auch gesunde Lebensjahre zu verlängern“, betont der Kardiologe. Interventionsziele sind daher die Reduktion der kardiovaskulären Sterblichkeit, die Verhinderung nicht-tödlicher kardiovaskulärer Ereignisse, die Vermeidung der Progression der Erkrankung sowie die Verbesserung der Lebensqualität durch Symptomkontrolle. Das schafft nicht nur ein Plus an individueller Lebensqualität, sondern trägt auch zur Entlastung des Gesundheitssystems bei.
Risikofaktoren kontrollieren: Wissen schützt
Ein zentrales Thema dabei ist die Kontrolle modifizierbarer Risikofaktoren. Delle Karth betont, dass Prävention nicht bei der ärztlichen Intervention beginnen kann, sondern schon beim Wissen und dem Verständnis für diese Risikofaktoren in der Bevölkerung ansetzen muss. Der Leitsatz „Know your numbers“ soll Menschen dazu befähigen, ihre Gesundheitswerte zu kennen und auch einordnen zu können. Dazu gehören einige zentrale Zielwerte, wie etwa jene von Blutdruck, Blutzucker, LDL-Cholesterin oder des Body-Mass-Index (BMI). „Diese Zahlen sollen nicht nur medizinisches Fachpersonal im Zuge einer Behandlung leiten, sondern auch Patientinnen und Patienten zu einem selbstverantwortlichen Handeln befähigen“, betont Delle Karth.
Eine deutsche Studie zeigt, dass sich rund 90 Prozent der Patientinnen und Patienten nach einem Myokardinfarkt über ihre Erkrankung und Risikofaktoren gut informiert fühlen. Doch nur 15 Prozent kennen konkret ihren Zielwert für LDL-Cholesterin. Über die Hälfte erreicht trotz Information nicht den empfohlenen Blutdruckwert – ein Umstand, der deutlich macht, wie groß die Lücke zwischen Wissen und tatsächlichem Verhalten ist. Delle Karth plädiert daher für standardisierte Aufklärungskampagnen und regelmäßige Evaluierung: Das Ziel muss sein, nicht nur zu informieren, sondern Verhaltensänderungen messbar zu fördern. Wichtig ist ihm auch die Bedeutung körperlicher Aktivität, denn bereits eine geringe Bewegungssteigerung hat messbare Effekte: „Es geht nicht darum, aus allen Menschen Spitzensportlerinnen und -sportler zu machen, sondern um den Abbau passiver Lebenszeit.“ Gestützt auf europäische Leitlinien, sind weitere präventive Empfehlungen der Verzicht auf Tabak- und übermäßigen Alkoholkonsum, die Vermeidung und Behandlung von Übergewicht sowie das Screening und die frühzeitige Behandlung von Hyperlipidämie, Diabetes und Hypertonie. Ein Versäumnis sieht Delle Karth in der geschlechterspezifischen Versorgung: „Während junge Männer im Rahmen der Stellung routinemäßig gescreent werden, fehlen vergleichbare Programme für Frauen.“
Delle Karth forderte beim PRAEVENIRE Denkertag einen Paradigmenwechsel in der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen – mit klaren Zielwerten, digitaler Unterstützung und mehr Aufklärung.
Inkretine als Game Changer?
Ein neues Kapitel in der kardiovaskulären Prävention wird aktuell durch Inkretin-basierte Medikamente aufgeschlagen. Ursprünglich wurden sie zur Behandlung von Diabetes entwickelt, aktuell zeigen Studienergebnisse, dass Inkretine auch bei nicht-diabetischen, übergewichtigen Patientinnen und Patienten kardiovaskuläre Risiken signifikant senken können. „Noch handelt es sich dabei um sehr kostenintensive Therapien. Doch ihre potenzielle Wirkung als präventive Maßnahme ist hoch und sollte daher in künftige Versorgungsmodelle einfließen“, fordert der Mediziner. Künftig, so hot Delle Karth, könnten auch digitale Hilfsmittel wie Wearables oder Apps sowie technologische Innovationen die Prävention und Therapie deutlich verbessern: kontinuierliches Blutdruckmonitoring und Aktivitätstracking, Apps zur Risikoabschätzung und Zielwertkontrolle oder telemedizinische Angebote. Damit diese Tools in die Breite kommen, braucht es jedoch eine neue Präventionskultur, die früh ansetzt, alle Altersgruppen einbezieht und die individuelle Risikokompetenz verbessert. Die ökonomischen Vorteile für das Gesundheitssystem sind neben der Verlängerung der individuellen gesunden Lebensjahre unumstritten.