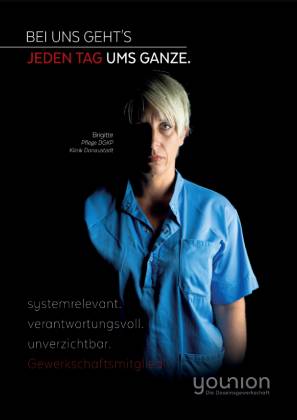Hörschwierigkeiten sind weit mehr als ein individuelles Problem. Schätzungen gehen davon aus, dass Millionen Menschen in Österreich von einer mehr oder weniger starken Form der Hörbehinderung betroffen sind – mit teils massiven Folgen für die soziale Teilhabe, die psychische Stabilität, die geistige Fitness und die wirtschaftliche Produktivität. | von Mag. Renate Haiden, MSc
Trotz der großen Bedeutung wird das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor unterschätzt. Das Wissen, dass unbehandelte Hörminderungen ein Risikofaktor für Demenz, Depression und Vereinsamung sind, ist kaum verbreitet. Damit fehlt auch das Bewusstsein für Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm oder zur regelmäßigen Vorsorge. Zudem sind die volkswirtschaftlichen Folgekosten enorm, denn wenn es an der Möglichkeit fehlt, mit Mitmenschen ausreichend zu kommunizieren, ist auch die Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem Arbeitsplatz massiv eingeschränkt. Damit sinken die Chancen auf ein selbstbestimmtes und finanziell abgesichertes Leben.
Im Rahmen eines PRAEVENIRE Gipfelgesprächs mit Vertreterinnen und Vertretern aus Medizin und Gesundheitswesen, der Politik, der Sozialversicherung und der Industrie sowie der Selbsthilfe wurde deutlich, dass Österreich dringend eine Strategie für gutes Hören benötigt. Sie muss bei der Gesundheitskompetenz der Jüngsten ansetzen, die Prävention einschließen und die frühzeitige Diagnose ebenso abdecken wie die Versorgung und Rehabilitation.
Vielfältige Ursachen erfordern differenzierte Strategie
Hörverlust zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Europa. In Österreich sind rund 1,7 Millionen Menschen von einer Hörminderung betroffen. Die Dunkelziffer ist hoch und die Zahl der Betroffenen steigt nicht zuletzt auch aufgrund der demografischen Entwicklung. Global betrachtet geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon aus, dass im Jahr 2050 etwa 2,5 Milliarden Menschen mit einer relevanten Hörminderung leben werden, davon rund 700 Millionen mit einem so schweren Verlust, dass sie auf eine Hörgeräte- oder Implantatversorgung angewiesen sein werden. Eine Hörminderung (Hypakusis) beschreibt eine Einschränkung des Hörvermögens, bei der Betroffene Geräusche, Sprache oder Umweltlaute nicht mehr in normaler Lautstärke und Klarheit wahrnehmen können. Sie kann in jedem Lebensalter auftreten und ist keine einheitliche Erkrankung, sondern ein Sammelbegriff für unterschiedlichste Störungen des Hörvermögens, die reversibel oder irreversibel sind. Die Ursachen reichen von Trommelfellverletzungen bis hin zu Folgen von Infektionen sowie neurologischen Auslösern wie Tumoren oder Schlaganfällen. Genetische Ursachen führen schon im Kindesalter zu Hörverlust und akute Ereignisse wie ein Hörsturz oder Lärmunfälle können in jedem Alter auftreten. Eine leichte Hörminderung bedeutet, dass leises Sprechen bei Umgebungsgeräuschen schwer verständlich ist. Wenn Gespräche bei klarer Lautstärke nur eingeschränkt zu verstehen sind, spricht man bereits von einer mittleren bis schweren Hörminderung. Hochgradig schwerhörig sind Menschen, die Alltagsgesprächen ohne Hörhilfen nicht mehr folgen können. Die Einteilung nach Schweregrad, Ort der Schädigung und Zeitpunkt des Auftretens – angeboren oder erworben – ist wichtig, um eine zielgerichtete Diagnostik und Therapie einzuleiten.
Ökonomische Folgen für Gesellschaft und System
Die gesundheitlichen Auswirkungen reichen weit über das Organ „Ohr“ hinaus. Hörverlust führt nicht nur zu Kommunikationsproblemen mit all seinen Folgen, sondern erhöht das Risiko für Demenz um das Zwei- bis Fünffache, wie internationale Studien belegen. Durch die Verwendung von Hörgeräten kann dieses Risiko wirksam verringert werden. Betroffene mit einem Hörschaden sollten möglichst früh mit einem Hörgerät versorgt und therapiert werden, denn das Gehirn kann die Fähigkeit verlieren, Geräusche oder Sprache zu verarbeiten. Das Hören ist auch an die geistige Leistungsfähigkeit gekoppelt, daher ist der rasche Ausgleich eines beginnenden Hörverlustes, etwa im fortschreitenden Alter, wichtig, um beispielsweise eine erhöhte Sturz- und Unfallgefahr zu verringern, Denn: wer schlecht hört, nimmt akustische Warnsignale schlechter war. Zudem ziehen sich Menschen mit Hörbeeinträchtigungen häufiger aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, und verlieren so wichtige soziale Schutzfaktoren für die Gesundheit. Damit wird deutlich, dass gutes Hören nicht nur eine Frage der Lebensqualität ist, sondern eine zentrale Säule der Prävention anderer gesundheitlicher Beeinträchtigungen ist. Die gesundheitlichen Belastungen sind eng mit der ökonomischen Dimension verknüpft. Unbehandelte Schwerhörigkeit verursacht laut WHO jährlich globale Kosten von rund 980 Milliarden US-Dollar, die durch Produktivitätsverluste, Gesundheitskosten und indirekte Folgen wie erhöhte Pflegebedürftigkeit entstehen. Für Österreich gibt es keine validen Zahlen, doch lässt sich aus internationalen Vergleichen ableiten, dass jährlich mehrere Milliarden Euro an Folgekosten aufgrund von Hörbeeinträchtigungen entstehen. Schon geringe Verbesserungen bei Früherkennung und Versorgung hätten einen spürbaren Effekt. Die WHO geht im World Report On Hearing (2021) für jeden in Gehörschutz- und Gehörakustik investierten Euro von einem volkswirtschaftlichen Return On Investment in der Höhe von 31 Euro innerhalb von zehn Jahren aus.
Die Kosten entstehen durch reduzierte Arbeitsfähigkeit, erhöhte Krankenstände, Frühpensionierungen und einen erhöhten Versorgungsbedarf im Alter. Gerade im Kontext des Fachkräftemangels ist der Verlust von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gravierend, denn wenn schon in jungen Jahren eine Hörminderung auftritt, gestaltet sich bereits die Schul- und Bildungskarriere schwierig. Jüngste Studien aus Deutschland zeigen auch den positiven Zusammenhang zwischen erhaltenem Hörvermögen und spätem Pensionsantrittsalter auf. Demgegenüber sind die Kosten für Prävention, Screening und Hörgeräteversorgung verhältnismäßig gering – eine Investition, die sich für das Gesundheitssystem, die Sozialversicherung und die gesamte Volkswirtschaft vielfach auszahlt.
Herausforderungen in der Versorgung
Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Netz an HNO-Ärztinnen und -ärzten, Hörakustikerinnen und Hörakustikern sowie spezialisierten Kliniken. Dennoch gibt es Herausforderungen, denn trotz all dieser Angebote stellt bereits die Früherkennung die erste Hürde dar. Im Durchschnitt vergehen sieben Jahre, bis Betroffene mit einer relevanten Hörminderung ein Hörgerät nutzen. Der Grund ist einfach erklärt: Das Tragen von Hörgeräten ist nach wie vor mit Stigmata behaftet, die viele Menschen von einer frühzeitigen Versorgung abhalten. Umgekehrt haben Studien aber belegt, dass Menschen im Umfeld von Hörgeräteträgern viel eher bereit sind, selbst eines zu tragen. Hörschäden entstehen oft früh, etwa durch das Hören lauter Musik, fehlenden Gehörschutz im Beruf oder Infektionen im Kindesalter. School Nurses könnten gerade in der jungen Generation auch zum Thema Hören aufklären und beraten. Es ist aber nicht nur die „Generation Kopfhörer“, der das Bewusstsein für die Bedeutung von Hörschwierigkeiten fehlt. Quer durch alle Altersklassen bleibt der Weg zu einem ärztlichen Gespräch aufgrund fehlender Gesundheitskompetenz aus. Erst wenn es gravierende Einschränkungen, die Familie und Freunde ebenso belasten, wie die Betroffenen selbst, oder Beschwerden gibt, sucht man eine Ärztin oder einen Arzt auf. Die Versorgungswege und auch die Erstattung vonseiten der Krankenkassen sind zwar gut ausgebaut, dennoch fragmentiert: zwischen Diagnose, Hörgeräteanpassung und Rehabilitation fehlen standardisierte Schnittstellen. Vor allem sind es die niederschwelligen Angebote, die schon im schulischen Umfeld beginnen müssten, indem Awareness für das Thema geschaffen wird, und bis hin zu Vor-Ort-Beratungen in Apotheken, bei Seniorenverbänden oder in Alten- und Pflegeheimen reichen sollten. Besonders problematisch ist die Versorgung von Menschen mit komplexen Hörstörungen. Cochlea-Implantate bieten hier oft eine sehr effektive Lösung, werden aber noch immer nicht flächendeckend und zeitgerecht eingesetzt. Hinzu kommt, dass viele Betroffene nicht ausreichend über die Optionen informiert sind.
Berufskrankheit: Lärmschwerhörigkeit
Auch die Arbeitswelt ist stark betroffen: Lärmschwerhörigkeit zählt zu den häufigsten Berufskrankheiten, und fehlende Prävention führt nicht nur zu gesundheitlichen Belastungen, sondern auch zu Einbußen bei Arbeitsfähigkeit und Fachkräftepotenzial. So sind vor allem Beschäftigte in der Bauwirtschaft, der Metallindustrie, im Verkehrswesen, der Landwirtschaft oder in Bereichen mit starkem Maschinenlärm sind betroffen. Laut Daten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wurde die Berufskrankheit Lärmschwerhörigkeit im Jahr 2024 bei 758 Personen anerkannt, die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Lärmbelastungen am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu minimieren. Rechtsgrundlage dafür bildet die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (VOLV), die auf dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) basiert. Sie legt Grenzwerte für Lärmexposition fest, die den Einsatz von Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen von Gehörschutz, erforderlich machen. Eine Überprüfung erfolgt durch Lärmmessungen, Betriebsbegehungen und verpflichtende arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei der Arbeitsmedizinerin oder beim Arbeitsmediziner.
Trotz klarer gesetzlicher Vorgaben und Sanktionen bei Verstößen bleibt die Umsetzung herausfordernd, da Gehörschutz nicht konsequent getragen wird – er wird, so wie bei persönlicher Schutzausrüstung häufig der Fall, als lästig und unpraktisch im Arbeitsalltag empfunden. Eine Verbesserung kann individuell angepasster Hörschutz leisten, der den Tragekomfort erhöht und auf die jeweilige Lärmsituation optimal angepasst werden kann.
HNO-Ärztinnen und -Ärzte müssen die Berufskrankheit melden, das trifft bei den Betroffenen häufig auf großes Unverständnis und Unsicherheit. Prävention und regelmäßige Sensibilisierung sind daher am Arbeitsplatz zentrale Bausteine, um die Zahl lärmbedingter Hörschäden in Österreich zu reduzieren. Betriebe können einen wichtigen und ebenso niederschwelligen Beitrag leisten, etwa durch Angebote wie regelmäßige Hörtests für Mitarbeitende, durch betriebliches Gesundheitsmanagement oder den gezielten Einsatz von Präventionsprogrammen.
Das Thema sichtbar machen
Expertinnen und Experten fordern einhellig eine nationale Strategie, die bereits bei Kindern und Jugendlichen ansetzen muss. Dazu gehören verpflichtende Hörscreenings in Schulen, gezielte Aufklärungskampagnen über Lärmprävention und die Sensibilisierung von Eltern und Lehrkräften. Neben der Schul- und Elternbildung braucht es Kampagnen zum Thema Früherkennung und Frühversorgung.
Ein Blick nach Europa zeigt, wie Versorgung auch anders organisiert werden kann. In Deutschland ist zum Beispiel die Hörrehabilitation eng mit der Demenzprävention verknüpft. Dort werden Patientinnen und Patienten mit einem neu diagnostizierten Hörverlust aktiv zu Präventionsprogrammen eingeladen. In Skandinavien gibt es großflächige Screening-Programme für Kinder und Jugendliche, die Hörprobleme schon früh identifizieren. In Großbritannien haben Aufklärungskampagnen maßgeblich dazu beigetragen, das Stigma rund um Hörgeräte zu reduzieren.
Digitale Lösungen werden zunehmend eingesetzt, um Zugangsbarrieren zu überwinden. Sie bilden eine gute Grundlage für die Sensibilisierung und den folgenden, höchst individuellen Prozess der Versorgung. Dazu gehören Screening-Apps, telemedizinische Beratungen oder KI-gestützte Diagnostik, die niederschwellig verfügbar ist. Während Deutschland zum Beispiel für Tinnitus eine „App auf Rezept“ verordnen kann, gibt es in Österreich noch keine klare gesetzliche Regelung zur Erstattung von digitalen Gesundheitsanwendungen, daher wird ihr Potenzial nicht genutzt.
Damit moderne Hörversorgung funktioniert, braucht es klare Strukturen im Gesundheitssystem. Auch passende Rehabilitationsangebote und Unterstützung durch die Selbsthilfe könnten in einen nationalen Versorgungsplan aufgenommen werden.
Initiative „Gutes Hören 2030“
Mit der Initiative „Gutes Hören 2030“ will PRAEVENIRE das Thema weiterhin mit Expertinnen und Experten diskutieren und die Ergebnisse und Forderungen auf die gesundheitspolitische Agenda setzen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Hörens zu stärken, konkrete politische Maßnahmen einzufordern und die Zusammenarbeit aller relevanten Akteurinnen und Akteure zu fördern. Die Barrieren für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen müssen abgebaut werden und die Bedeutung des Hörens in nationale Gesundheits-, Präventions- und Demenzstrategien integriert werden.
Die Diskussion zeigt deutlich, dass Österreich die Chance hat, bei der Hörversorgung eine Vorreiterrolle einzunehmen – vorausgesetzt, es werden rasch die richtigen Weichen gestellt. Dazu gehören ein konsequenter Ausbau von Prävention und Vorsorge, die Förderung moderner Technologien, eine bessere Vernetzung der Versorgungsstrukturen und die Entstigmatisierung von Hörhilfen in der Öffentlichkeit. Stakeholder aus Politik, Sozialversicherung, Gesundheitswesen und Industrie sind gefordert, © BEN LEITNER (4) gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.