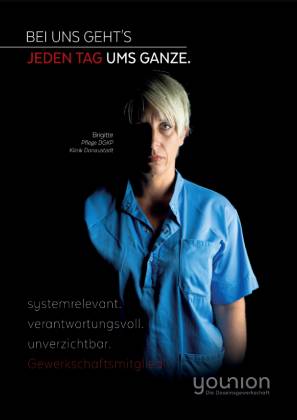Wenn sich Stakeholder, Fachexpertinnen und Gesundheitspolitiker zum 5. PRAEVENIRE Gipfelgespräch am Fuße der Rax im Parkhotel Hirschwang einfinden, ist eines gewiss: die Zukunft der kinder- und Jugendgesundheit steht im Zentrum. Vom gesellschaftlichen Umgang mit digitalen Medien über strukturelle Herausforderungen in der Versorgung bis hin zu konkreten Maßnahmen in der Kinder- und Jugendlichenrehabilitation – der thematische Bogen war weit gespannt, die Diskussionen oen und lösungsorientiert. | von Karl Innauer
Zwei Tage lang stand das Thema Kinder- und Jugendgesundheit in all seinen Facetten im Mittelpunkt intensiver Diskussionen. Das 5. PRAEVENIRE Gipfelgespräch in Hirschwang brachte hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Zivilgesellschaft zusammen, um gemeinsam die aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätze für ein gesundes Aufwachsen zu beleuchten. Der erste Tag widmete sich ganz dem Einfluss digitaler Medien auf junge Menschen und deren psychische Gesundheit. Der zweite Tag bot mit politischen Impulsen, einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion und vier themenspezifischen Workshops einen umfassenden Überblick über den Reformbedarf und neue Strategien in der Versorgung.
Medienwelt und psychische Belastung – Wie Social Media unsere Jugend beeinflusst.
Der erste Veranstaltungstag rückte die Auswirkungen digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche in den Fokus. Besonders die Verbreitung von Falschinformationen, die psychischen Folgen exzessiver Online-Nutzung sowie die daraus resultierenden gesellschaftlichen Herausforderungen wurden eingehend beleuchtet. Nach den Begrüßungsworten von Obmann Markus Wieser und einer Videobotschaft von Mag. Peter McDonald (ÖGK) bildeten zwei Keynotes die inhaltliche Grundlage des Tages und lieferten wertvolle Impulse für das anschließende Plenum. Journalistin und Digitalexpertin Ingrid Brodnig schilderte eindrücklich, wie sich sogenannte Fake News und destruktive Narrative unter Jugendlichen verbreiten. Am Beispiel des fiktiven „National Rape Day“ auf TikTok zeigte sie auf, wie Unsicherheit, Angst und Misstrauen durch virale Videos geschürt werden können – mit gravierenden Folgen für das Sicherheitsgefühl junger Menschen. Selbst in ländlichen Regionen schlugen Lehrkräfte Alarm, als ihre Schülerinnen und Schüler verstört und verängstigt auf solche Inhalte reagierten. Brodnig machte deutlich, dass Jugendliche andere Informationskanäle nutzen als Erwachsene und daher auch andere Desinformationsmuster zu erkennen sind. Sie forderte eine Aufklärung auf Augenhöhe – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern über digitale Bildungsformate, die an die Lebenswelt der jungen Generation anknüpfen. Schulen, Eltern und auch Plattformbetreiber stünden in der Verantwortung, ein Bewusstsein für Medienkompetenz zu schaffen. Im Anschluss sprach Prim. Dr. Georg Psota, langjähriger Chefarzt der Psychosozialen
Dienste in Wien über die psychischen Folgen der Dauerverfügbarkeit digitaler Reize. Sieben Stunden tägliche Bildschirmzeit außerhalb der Schule seien keine Seltenheit, berichtete Psota aus der Praxis. Er sprach sich für eine klar strukturierte, flächendeckende Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus. Dabei müsse der digitale Raum auch therapeutisch genutzt werden – allerdings auf seriöse, qualitätsgesicherte Weise.
Psota stellte die Monsenso-App, eine digitale Gesundheitsanwendung vor, die Jugendliche bei der Bewältigung psychischer Belastungen unterstützen soll. Er kritisierte die mangelnde gesetzliche Regulierung digitaler Gesundheitsapps in Österreich und forderte ein System, das Wirkung und Sicherheit überprüfbar macht. Sein Fazit: Digitale Tools können helfen – wenn sie verantwortungsvoll konzipiert und begleitet werden.
Das anschließende Plenum griff die Impulse beider Keynotes auf. Fachleute aus Bildung, Medizin und Sozialarbeit diskutierten u. a. die Frage, wie Gesundheitsbildung, Medienkompetenz und psychische Prävention im Bildungssystem verankert werden können. Breite Zustimmung fand der Vorschlag, Medienbildung verpflichtend in den Schulunterricht aufzunehmen und Lehrkräfte entsprechend auszubilden.
Politik trifft Praxis
Am zweiten Tag richtete sich der Blick auf strukturelle und politische Rahmenbedingungen. Markus Wieser, Obmann des Fördervereins für Kinder- und Jugendlichenrehabilitation, erönete mit einem Bericht über sein Gespräch mit EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi. Dabei sei das österreichische Modell der integrierten Kindergesundheit auf großes Interesse gestoßen. Wieser appellierte, Österreich solle seine Rolle als europäischer Vorreiter weiter aktiv gestalten.
Várhelyi richtete sich per Videobotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gipfels. Er unterstrich die Bedeutung eines sicheren digitalen Raums für junge Menschen und kündigte eine europäische Untersuchung zu den psychischen Auswirkungen sozialer Medien an. Weitere Schwerpunkte seiner Botschaft waren die Förderung der kardiovaskulären Gesundheit, der Ausbau des europäischen Gesundheitsdatenraums und die Stärkung von Forschung und Biotechnologie. 1,3 Milliarden Euro will die EU in psychische Gesundheit investieren – ein starkes Signal für den Schutz der jungen Generation.
Podiumsdiskussion: Kinder- und Jugendgesundheit als gesellschaftlicher Auftrag.
Im Zentrum des Vormittags stand die Podiumsdiskussion mit Staatssekretärin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Ulrike Königsberger-Ludwig, Andreas Huss, MBA, Obmann der ÖGK, Dr. Alexander Biach Generaldirektor der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), Mag. Dr. Elisabeth Bräutigam Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA NÖ) und Markus Wieser, Obmann des Fördervereins Kinder- und Jugendlichenrehabilitation in Österreich. Die Diskussion zeigte eindrucksvoll, wie groß der Handlungsbedarf, aber auch die Einigkeit über zentrale Zielsetzungen ist.
Königsberger-Ludwig betonte, dass Kinder nicht nur in medizinischer Hinsicht, sondern auch psychisch, sozial und digital besser begleitet werden müssen. Sie forderte die Verankerung psychischer Gesundheit in allen Bildungs- und Regierungsprogrammen. Bewegend war ihr Appell, Kinder stark zu machen – gegen Cybermobbing, soziale Ausgrenzung und psychischen Druck. Dabei müssten Eltern, Lehrkräfte und politische Entscheidungsträger gemeinsam Verantwortung übernehmen.
Andreas Huss hob hervor, wie entscheidend der Ausbau regionaler Versorgungsnetzwerke sei. Gesundheitskompetenz müsse früh gestärkt werden – etwa durch tägliche Bewegungsangebote und den Ausbau von Schulgesundheitsdiensten. Huss forderte, mehr auf Prävention als auf Reparaturmedizin zu setzen.
Alexander Biach ergänzte, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sei. Der elektronische ElternKind-Pass, die Integration aller relevanten Daten in ELGA und die sichere Nutzung von Gesundheitsdaten seien Meilensteine, die dringend umgesetzt werden müssten.
Elisabeth Bräutigam verwies auf die Rolle der Landesgesundheitsagenturen, die besonders in der Prävention Verantwortung trügen. Sie sprach sich für multiprofessionelle Teams an Schulen und für mehr Ressourcen für Sozialarbeit und Schulpsychologie aus.
Markus Wieser betonte abschließend, dass Kindergesundheit nur gelingen kann, wenn man sektorübergreifend denkt und handelt – vom Mutter-Kind-Pass über pädiatrische Versorgung bis hin zur Rehabilitation.
Thema 1: Psychische Gesundheit
Keynote-Speaker Univ.-Prof. Dr. Paul Plener von der MedUni Wien, skizzierte eindrücklich die Entwicklung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Internationale Daten zeigen eine dramatische Zunahme, insbesondere bei Angststörungen, Depressionen und Essstörungen. Besonders prekär: Österreich verfügt über keine aktuellen repräsentativen Erhebungen zur psychischen Gesundheit dieser Altersgruppe. Plener betonte, dass psychische Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden müsse. Er forderte eine langfristige Strategie, die sowohl auf präventive als auch auf therapeutische Maßnahmen setzt. Schulen seien dabei zentrale Orte der Intervention – mit psychologischer Unterstützung, altersgerechter Gesundheitsbildung und einer umfassenden Enttabuisierung psychischer Erkrankungen. Digitale Angebote könnten dabei helfen, Lücken zu schließen, müssten jedoch qualitätsgesichert und sozial eingebettet sein.
Im Workshop diskutierten Expertinnen und Experten aus Psychiatrie, Pädagogik und Sozialarbeit über konkrete Maßnahmen zur Stärkung psychischer Gesundheit im Kindesund Jugendalter. Ein zentrales Ergebnis war die Forderung nach einem nationalen Gesundheitsmonitoring, um erstmals verlässliche Daten zu bekommen. Weiters wurde der flächendeckende Ausbau von niederschwelligen Beratungsangeboten gefordert – sowohl analog in Schulen als auch digital über Apps oder Chatangebote. Besonders betont wurde die Rolle der Elternarbeit und die Stärkung von Resilienz ab dem Kindergartenalter. Auch der Ausbau ambulanter Versorgungseinheiten sowie ein erleichterter Zugang zu therapeutischen Leistungen wurden als notwendig identifiziert.
Thema 2: Digitalisierung und Pädiatrie
Nach einem umfassenden Vortrag von Prim. Dr. Roland Berger, Leiter der Abteilung Kinderheilkunde mit Neonatologie des St. Josef Krankenhaus in Wien, über aktuelle Hürden und Potenziale digitaler Dateninfrastruktur in der Pädiatrie entwickelte sich eine lebhafte Debatte über das „Datenchaos“ in Österreichs Gesundheitssystem. Berger zeigte auf, wie fragmentiert die bestehenden digitalen Lösungen sind und wie wenig interoperabel aktuelle Systeme miteinander arbeiten. Er stellte das geplante Modell eines digitalen Eltern-Kind-Passes vor, der nicht nur die bisherigen Papierdokumente ersetzen, sondern auch Entwicklungsschritte, Impfungen und psychosoziale Parameter erfassen soll. Berger betonte die Notwendigkeit, diesen Pass mit ELGA zu verknüpfen und ihn sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für Eltern intuitiv bedienbar zu gestalten. Die Workshopgruppe arbeitete an einer Liste von Kernanforderungen: Neben der sofortigen Einführung des digitalen Eltern-Kind-Passes wurde auch eine vollständige Integration aller Kinderimpfungen in ELGA gefordert. Weitere Punkte waren die Möglichkeit zur anonymisierten Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschung, die Vereinfachung digitaler Schnittstellen in der Primärversorgung sowie mehr Investitionen in Gesundheits-IT.
Thema 3: Adipositas und Diabetes
Mag. Dr. Manuel Schätzer, Bundeskoordinator, Ernährungswissenschafter bei SIPCAN, präsentierte alarmierende Zahlen: Je nach Altersgruppe sind rund 30–35 Prozent der Kinder in Österreich übergewichtig oder adipös. Besonders besorgniserregend ist der Trend, dass vor allem sozial benachteiligte Kinder betroen sind. Die Zahl der an Typ-2-Diabetes erkrankten Jugendlichen steigt. Schätzer machte klar, dass Adipositas kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem sei. Er kritisierte die bisherige Fragmentierung der Präventionsangebote und forderte einen systemischen Ansatz.
Im Workshop wurde intensiv über mögliche Lösungsansätze debattiert. Neben täglichen Bewegungseinheiten in Schulen sprachen sich viele Teilnehmende für eine gesetzlich verpflichtende, gesundheitsfördernde Schulverpflegung aus. Auch die Verankerung von Ernährungskompetenz im Lehrplan wurde als zentrales Ziel identifiziert. Ein besonders intensiver Diskussionspunkt war die bessere Einbindung von Eltern und das Angebot niederschwelliger Familienprogramme zur gesunden Lebensweise. Weitere Forderungen betrafen den Ausbau von Bewegungsräumen im öentlichen Raum, steuerliche Anreize für gesundes Essen und die Förderung digitaler Präventionsangebote.
Thema 4: Kinder- und Jugendlichenrehabilitation
Dr. Eva-Maria Mostler (ÖGK) und Prim. Assoz. Prof. Dr. Jutta Falger, ärztliche Direktorin des Kinderrehazentrums kokon Bad Erlach, schilderten die enormen Herausforderungen in der Rehabilitationslandschaft: langwierige Antragsprozesse, mangelnde Standards, unzureichende Kommunikation zwischen Akteuren. Besonders kritisch wurde die fehlende Information für Eltern und Ärzte gesehen, welche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Reha-Antrag erfüllt sein müssen.
Die Workshopteilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiteten einen umfassenden Maßnahmenkatalog: Neben einem einheitlichen digitalen Reha-Antragssystem wurde ein strukturierter Ablauf von der Antragstellung über die Aufnahme bis zur Nachbetreuung gefordert. Standards zur Definition von Reha-Fähigkeit, verpflichtende Schulungen für Hausärztinnen und -ärzte sowie ein zentrales Informationsportal wurden angeregt. Auch die schulische Wiedereingliederung nach der Reha – oft mit großem Anpassungsdruck verbunden – müsse systematisch begleitet werden. Besonders betont wurde die Notwendigkeit, auch psychische Erkrankungen als Reha-indizierende Faktoren stärker zu berücksichtigen und Kapazitäten entsprechend auszubauen.
Resümee
Zum Abschluss des zweiten Tages zog Markus Wieser ein prägnantes Resümee. Die Diskussionen zeigten klar: Die Herausforderungen sind groß, aber es gibt bereits viele praktikable Lösungsansätze. Nun gelte es, diese in konkrete politische Maßnahmen zu übersetzen.
Keynotespeaker
•Roland Berger
•Ingrid Brodnig
• Jutta Falger
•Eva-Maria Mostler
•Paul Plener
•Georg Psota
•Manuel Schätzer
Videobotschaft
•Peter McDonald
•Olivér Várhelyi