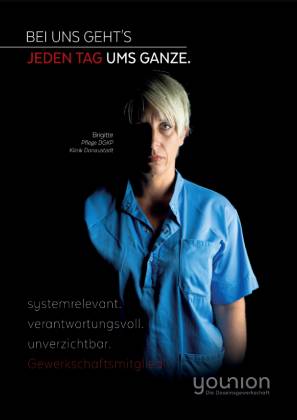Von der Impfskepsis bis zur Digitalisierung, von Früherkennung bis zur wohnortnahen Versorgung: Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit, gibt Einblick in zentrale Weichenstellungen für eine präventionsorientierte Gesundheitspolitik und beschreibt, warum Gesundheitskompetenz der Schlüssel zur Systemeffizienz ist. | von Mag. Renate Haiden, MSc.
Prävention statt Reparaturmedizin ist nur einer der Leitsätze, die aktuell die Gesundheitspolitik prägen. Die größten Hebel für eine verbesserte Gesundheitsversorgung liegen aber nicht nur in der Bewusstseinsbildung und dem Ausbau der Vorsorge, sondern auch in der Modernisierung und Effizienzsteigerung. Wie die Pläne in der Versorgungsrealität ankommen und welche Strategien verfolgt werden, beschreibt Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit.
Periskop: Wo sehen Sie aktuell die größten Hebel, um zu mehr Vorsorge zu motivieren?
Königsberger-Ludwig: Nur wenn wir Gesundheitsvorsorge in den Mittelpunkt stellen, können wir langfristig Kosten im System senken und den Menschen in Österreich mehr gesunde Lebensjahre ermöglichen. Deshalb ist uns der Ausbau von Präventionsprogrammen ein zentrales Anliegen. Ein wichtiger Hebel liegt in der Stärkung der Impfprogramme. Während für Kinder und Jugendliche bereits ein kostenloses Impfangebot besteht, wollen wir auch das Impfprogramm für Erwachsene weiter ausbauen. Doch Prävention ist weit mehr als Impfen. Es geht auch darum, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu erhöhen, und hier spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Der Zugang zu verlässlichen Gesundheitsinformationen muss für alle Menschen niederschwellig und in allen Lebenslagen möglich sein, zum Beispiel über seriöse Gesundheits-Apps. Es gibt bereits eine Vielzahl an Initiativen, auf die wir aufbauen können: von der Suchtpräventionsstrategie über die Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie bis hin zur Frauengesundheitsstrategie, dem nationalen Krebsrahmenprogramm oder Angeboten wie dem Rauchfrei Telefon. Auch Aktivitäten im schulischen Bereich leisten einen wertvollen Beitrag. Jetzt müssen wir in die Umsetzung kommen.
Die Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Empfehlungen hat insbesondere seit der Pandemie zugenommen. Wie kann das Vertrauen der Bevölkerung in Impfprogramme wieder gestärkt werden?
Impfungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Sie dienen nicht nur dem individuellen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen, sondern auch dem Schutz der gesamten Gesellschaft. Dieses Bewusstsein gilt es zu stärken, etwa durch den Verweis auf erfolgreiche Beispiele wie die nahezu vollständige Ausrottung der Kinderlähmung oder die Bedeutung hoher Durchimpfungsraten bei Masern zur Erreichung der Herdenimmunität.
Impfen ist auch ein Akt der Solidarität. Denn es gibt Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Umso wichtiger ist es, dass jene, die es können, ihren Teil zum Schutz der Gemeinschaft beitragen. Diese solidarische Verpflichtung sollte wieder stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte rücken.
Impfskepsis lässt sich nicht mit Druck begegnen, sondern mit verständlicher, seriöser Information. Gerade im digitalen Raum muss es möglich sein, verlässliche Gesundheitsinformationen einfach und überall zugänglich zu machen, etwa durch qualitätsgesicherte Gesundheits-Apps. Diese Präventionsarbeit muss früh ansetzen, schon bei Kindern, Jugendlichen und werdenden Eltern.
Impfprogramme sind ein zentraler Bestandteil präventiver Gesundheitspolitik, doch Prävention geht weiter: Bewegung, gesunde Ernährung und psychische Gesundheit sind ebenso wichtig. Österreich investiert aktuell nur rund fünf Prozent der Gesundheitsausgaben in Prävention – hier besteht Aufholbedarf. Ziel muss es sein, Menschen zu motivieren, selbst Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen – ohne erhobenen Zeigefinger, sondern durch positive, stärkende Botschaften.
Wie können wir die wohnortnahe Versorgung gezielt weiterentwickeln?
Ziel ist es, die Versorgung flächendeckend, niederschwellig und für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu gestalten. Eine abgestufte Versorgung ist dabei ein durchaus bewährtes Prinzip, auf dem ein zukunftsfähiges Versorgungssystem basieren kann – von der Primärversorgung über spezialisierte ambulante Leistungen bis hin zur stationären Versorgung. Dieses Prinzip ist nicht neu, es existiert bereits in vielen Konzepten und Beschlüssen, so etwa seit 2013 im Konzept des „Best Point of Service“ als Leitbild dafür, wie Patientinnen und Patienten zur richtigen Zeit am richtigen Ort behandelt werden können. Es braucht keine völligen Neuentwicklungen, sondern die konsequente Umsetzung bestehender Konzepte. Dazu gehört auch, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken und Menschen gezielt durch das System zu leiten – mit klaren Zuständigkeiten, guter Information und abgestimmten Versorgungsstrukturen.
Wie gelingt es, für Patientinnen und Patienten den Weg durch das System einfacher zu gestalten?
Ein modernes Gesundheitssystem muss sich an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten orientieren, das gilt nicht nur für die Versorgung selbst, sondern auch für die Navigation durch ein oft komplexes System. Dafür braucht es klare Strukturen, niederschwellige Angebote und eine gestärkte Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung. Ein weiterer Baustein ist die Ambulantisierung, denn sie kann Krankenhäuser entlasten und gleichzeitig Wartezeiten auf medizinische Leistungen verkürzen. Wir wollen die Versorgung stärker in den niedergelassenen Bereich verlagern, mit einem dichten Netz an Primärversorgungseinheiten (PVE), die wohnortnah, interdisziplinär und mit erweiterten Öffnungszeiten arbeiten. Auch hier liegt der Vorteil auf der Hand: kürzere Wartezeiten, längere Öffnungszeiten und eine Teamstruktur, die insbesondere für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv ist. Das schafft eine Win-win-Situation für das Gesundheitspersonal ebenso wie für die Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus ist im Regierungsprogramm vorgesehen, Therapie- und Pflegepraxen, Gemeinschaftspraxen nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe, einzurichten.
Sie betonen immer wieder die Bedeutung der Gesundheitskompetenz. Warum ist es so wichtig, dass sie gestärkt wird?
Gesundheitskompetenz ist ein Schlüsselbegriff, wenn es darum geht, Menschen in ihrer Eigenverantwortung zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wer weiß, wann welche Versorgung notwendig ist, reduziert Umwege im System und trägt zu einer zielgerichteten Inanspruchnahme von Leistungen bei. Ein wichtiges Instrument in diesem Zusammenhang ist die Gesundheitshotline 1450. Sie bietet rund um die Uhr kostenlos und niederschwellig Orientierung und vermittelt Patientinnen und Patienten an die richtige Stelle im Versorgungssystem, ob Hausarztpraxis, Fachärztin oder -arzt, Primärversorgungseinheit oder Spitalsambulanz. 1450 ist nicht dazu da, Versorgungsstrukturen zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Erste erfolgreiche Modelle gibt es bereits: In Wien können über 1450 Termine in PVEs gebucht werden, in der Steiermark vermittelt der Dienst nachts einen mobilen ärztlichen Einsatz, in Oberösterreich erfolgt eine direkte Zuweisung in Spitalsambulanzen. Diese regionalen Best-Practice-Beispiele zeigen das Potenzial. Nun gilt es, diese Erfahrungen zu bündeln und einen einheitlichen österreichweiten Standard zu etablieren, 1450 soll das digitale Gesundheits-Navi für ganz Österreich werden.
Gesundheitskompetenz soll früh gefördert werden. Wie kann das klappen?
Ein zentrales Instrument dafür ist der ElternKind-Pass. Die darin vorgesehenen Untersuchungen unterstützen die Früherkennung, die Behandlung von Krankheiten und die Kontrolle der kindlichen Entwicklung. Künftig soll der Eltern-Kind-Pass nicht nur bis zum fünften Lebensjahr, sondern bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet werden und stärker mit den Frühen Hilfen verknüpft werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Leistungen integriert, unter anderem ein Impfpass mit Erinnerungsfunktion. Damit sollen Impflücken vermieden werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt aber auch auf gesunder Ernährung und psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Hier hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Handlungsbedarf gezeigt, vor allem infolge der Pandemie und weiterer Krisen. Wir müssen daher Gesundheitsförderung direkt in den Bildungseinrichtungen verankern. So sollen künftig mehr sogenannte School Nurses sowie psychosoziale Betreuungsangebote an Schulen verfügbar sein. Gleichzeitig ist dabei auf eine gute Abstimmung mit dem pädagogischen Personal zu achten. Die Schulen dürfen nicht überfordert werden, denn viele Themen wie Finanzbildung, Gesundheitsbildung oder soziale Kompetenzen prasseln ohnehin schon auf das Bildungssystem ein.
Wie können Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen besser versorgt werden?
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zählen zu den häufigsten chronischen Leiden in Österreich. Sie sind nicht nur für einen großen Teil der Krankheitslast verantwortlich, sondern stellen auch das Gesundheitssystem vor zunehmende Herausforderungen. Ein Großteil der Erkrankungen ist auf wenige, gut bekannte Risikofaktoren zurückzuführen, wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, Fehlernährung und chronischer Stress. Schätzungen zufolge ließen sich bis zu 40 % der chronischen Erkrankungen durch das Management dieser Risikofaktoren verhindern. Deshalb liegt ein klarer gesundheitspolitischer Fokus auf der Stärkung der Präventionsarbeit. Dazu zählen zielgerichtete Gesundheitskampagnen ebenso wie lebensstilbasierte Programme zur Förderung von Bewegung und gesunder Ernährung. Doch Prävention allein genügt nicht – ebenso wichtig ist die Früherkennung.
Gerade bei chronischen Erkrankungen entscheidet der Zeitpunkt der Diagnose maßgeblich über den weiteren Krankheitsverlauf. Deshalb sollen Vorsorgeuntersuchungen ausgebaut und vor allem auch für vulnerable Bevölkerungsgruppen besser zugänglich gemacht werden. Bestehende Disease-Management-Programme sollen ausgebaut, besser koordiniert und vereinheitlicht werden. Das betrifft nicht nur die Inhalte, sondern auch die Strukturen: Die derzeit sehr heterogenen Leistungskataloge gehören auf den Prüfstand. Ziel muss ein einheitlicher, transparenter Leistungskatalog sein, der sowohl die Versorgungsrealität abbildet als auch klare Rahmenbedingungen für alle Leistungserbringerinnen und -erbringer schafft.
Wie kann der Zugang zur Krebsvorsorge verbessert werden?
Rund 45.000 Menschen erhalten in Österreich jedes Jahr eine Krebsdiagnose, etwa 400.000 leben mit der Erkrankung, und jährlich versterben rund 21.000 Menschen an den Folgen von Krebs. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose ist, denn sie erhöht nicht nur die Heilungschancen, sondern verbessert auch die Lebensqualität Betroffener deutlich.
Die onkologische Früherkennung ist daher ein zentraler Schwerpunkt der Gesundheitspolitik. Aktuell wird das nationale Krebsrahmenprogramm überarbeitet. Eine Herausforderung bleibt die niedrige Inanspruchnahme der Vorsorgeangebote. Diese Lücke soll durch gezielte Bewusstseinsbildung geschlossen werden. Vulnerable Gruppen, wie etwa Menschen mit Migrationshintergrund, müssen besser erreicht werden.
Welche Rolle kann Digitalisierung künftig im Gesundheitswesen spielen?
Moderne Technologien ermöglichen schnelleren Zugang zu Informationen, unterstützen Diagnose- und Therapieprozesse und sorgen für effizientere Abläufe. Vor allem in ländlichen Regionen oder bei eingeschränkter Mobilität kann etwa die Telemedizin den Zugang zur Versorgung erheblich erleichtern. Ein zentrales Prinzip lautet daher digital vor ambulant vor stationär. Doch persönlicher Kontakt, ärztliche Zuwendung und das vertrauensvolle Gespräch sind durch nichts zu ersetzen. Technologie soll entlasten und unterstützen, aber nicht den zwischenmenschlichen Kern medizinischer Betreuung ersetzen. Wenn Routinetätigkeiten und Dokumentation durch digitale Tools vereinfacht werden, bleibt mehr Raum für die persönliche Zuwendung, das Gespräch, das Zuhören. In diesem Sinne steht Digitalisierung nicht im Gegensatz zur sogenannten Zuwendungsmedizin, sondern kann sie sogar stärken.
Ein besonders vielversprechender Ansatz in diesem Kontext ist das Konzept des Social Prescribing. In Oberösterreich läuft dazu bereits ein Pilotprojekt, das zeigt, wie digitale Steuerung und menschliche Zuwendung erfolgreich zusammenspielen können.