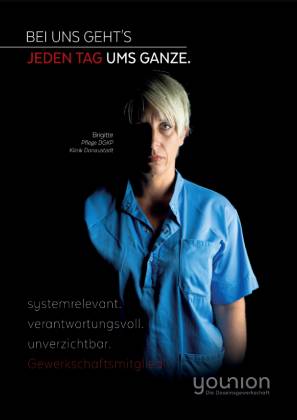Die Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien zählt zu den international führenden Einrichtungen ihrer Art. Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Markus Zeitlinger werden hier neue Arzneimittel und Therapien in allen Phasen der klinischen Prüfung erforscht – von der ersten Anwendung am Menschen bis zur Zulassung. Mit dem neuen Center for Translational Medicine (CTM) entsteht bis 2026 das größte und modernste Zentrum für translationale Forschung in Europa. Es soll die Vernetzung zwischen Labor, Klinik und Patientinnen und Patienten stärken – und die Medizin der Zukunft beschleunigen.
Wenn Markus Zeitlinger von klinischer Forschung spricht, klingt Begeisterung mit, aber auch Respekt. „Jede Studie ist eine Verantwortung – gegenüber den Menschen, die daran teilnehmen, und gegenüber der Gesellschaft, die auf Fortschritt vertraut“, sagt der Vorstand der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie. Seine Abteilung an der MedUni Wien gilt längst als europäische Referenz für Qualität und wissenschaftliche Tiefe.
Exzellenz mit System – Forschung, die Europa prägt
Seit Mitte der 1990er-Jahre wurden hier nahezu eintausend klinische Studien geplant, begleitet und abgeschlossen – vom ersten Versuch eines neuen Wirkstoffs am Menschen bis zu großen internationalen Prüfungen, die den Weg zur Zulassung ebneten. Die Klinik führt eigene akademische Projekte ebenso durch wie Kooperationen mit Biotech- und Pharmaunternehmen. Viele der hier betreuten Studien haben zur Markteinführung innovativer Arzneimittel beigetragen, die heute weltweit im Einsatz sind. Diese Leistungsbilanz ist das Ergebnis einer klaren Philosophie: klinische Forschung als interdisziplinäre Teamarbeit. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Biostatistikerinnen und Biostatistiker, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, Datenmanagerinnen und Datenmanager, technische Assistentinnen und Assistenten – sie alle bilden ein Netzwerk, das wissenschaftliche Exzellenz und klinische Erfahrung verbindet. Die Klinik arbeitet eng mit anderen Kliniken der MedUni Wien und Abteilungen des Universitätskrankenhauses AKH Wien zusammen, das mit über 1.700 Betten eines der größten Krankenhäuser Europas ist. Dadurch können auch komplexe Studien mit Patientinnen und Patienten durchgeführt werden, die spezialisierte Betreuung erfordern.
Hinter dieser Struktur steht eine Haltung, die man in Wien als selbstverständlich betrachtet: Forschung und Versorgung sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Aufgabe. Wer Heilung verbessern will, muss verstehen, wie Therapie funktioniert – und das gelingt nur, wenn Ärztinnen und Ärzte, Forschende und Pflegekräfte eng zusammenarbeiten.Betreuung erfordern
Vom Labor zum Menschen – und wieder zurück
Klinische Pharmakologie ist mehr als das Testen neuer Substanzen. Sie erforscht, wie Wirkstoffe im Körper wirken, wie sie verteilt, verstoffwechselt und ausgeschieden werden – und wie all das durch Alter, Genetik oder Begleiterkrankungen beeinflusst wird. In Wien werden diese Fragen mit einem Arsenal modernster Methoden untersucht.
Besonders prägend ist die Forschung zu Antibiotika. Mit bildgebenden Verfahren wie der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der Mikrodialyse lässt sich u.a. verfolgen, wie ein Medikament bis in die kleinsten Gewebeareale gelangt und welche Stoffwechseländerungen ausgelöst werden. So entstehen Daten, die helfen, Dosierungen präziser festzulegen und Resistenzen zu vermeiden. Auch das Herz-Kreislauf-System steht im Fokus. Die Wiener Forscherinnen und Forscher entwickeln neue, schonende Messverfahren, mit denen sich Durchblutung, Blutdruck oder Gefäßreaktionen beurteilen lassen. Daraus entstehen Erkenntnisse, die unmittelbar in die Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck einfließen. In der Ophthalmologie – also der Arzneimittelforschung am Auge – werden Wirkstoffe gegen Glaukom, diabetische Netzhautschäden und altersbedingte Makuladegeneration untersucht. Hier verbindet sich klinische Erfahrung mit technologischem Pioniergeist: Miniatursensoren und hochauflösende Bildsysteme erlauben es, Veränderungen im Auge millimetergenau zu beobachten.
Die Arbeitsgruppe für Hämatologie und Immunologie beschäftigt sich mit den Abwehrmechanismen des Körpers und entwickelt Therapien für allergische, entzündliche sowie Bluterkrankungen. Ein Beispiel ist ein modifiziertes Enzym, das bei Krankheitsbildern mit überschüssigem Histamin wie Mastozytose, chronische Urticaria oder Asthma eingesetzt werden könnte – ein Projekt, das in Wien entwickelt und patentiert wurde. All diese Forschungsstränge laufen in einem Ziel zusammen: Erkenntnisse so zu übersetzen, dass sie Patientinnen und Patienten zugutekommen. Deshalb begleitet die Klinik nicht nur frühe Studienphasen, sondern auch späte Phase-3-Prüfungen, Real-World-Analysen und gesundheitsökonomische Projekte.
Qualität ist kein Zufall
Wer an klinischen Studien teilnimmt, vertraut sein Wohlbefinden der Wissenschaft an. Dieses Vertrauen muss verdient werden. Es gelten deshalb strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter absolviert jährlich Schulungen. Studienabläufe werden durch externe Audits überprüft, nationale (AGES) und internationale Behörden wie die Europäische Arzneimittelagentur und die amerikanische FDA inspizieren die Einrichtung regelmäßig.
Doch Qualität entsteht nicht nur durch Kontrolle, sondern durch Kultur. Die Klinik legt großen Wert auf offene Kommunikation und gegenseitige Verantwortung. Klinische Studien bieten für die daran teilnehmenden Patientinnen und Patienten Vorteile durch einen frühen Zugang zu innovativen Therapien, wo vielfach keine alternativen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Studien ermöglichen den Vergleich neuer Behandlungsoptionen mit bestehenden Standardtherapien, sodass medizinischer Fortschritt messbar wird. Durch die neue EU CTR, die darauf abzielt die Arzneimittelentwicklung in Europa zu vereinheitlichen, wird eine hohe Qualität und Transparenz gewährleistet. Alle in der EU genehmigten Studien sind über das sogenannte CTIS-Portal öffentlich einsehbar. Das bedeutet, dass nicht nur medizinisches Fachpersonal, sondern auch Patientinnen und Patienten Zugang zu Informationen erhalten. Das stärkt das Vertrauen in klinische Forschung. Jede Studienteilnehmerin und jeder Studienteilnehmer wird individuell betreut, medizinisch überwacht und umfassend informiert. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Koordinatorinnen sowie Koordinatoren arbeiten eng zusammen, um Forschung so sicher und transparent wie möglich zu gestalten. Diese Haltung hat der Wiener Pharmakologie internationales Ansehen eingebracht. Viele Partnerinnen und Partner aus Industrie und Wissenschaft entscheiden sich gezielt für Wien, weil hier wissenschaftliche Präzision mit menschlicher Zuwendung verbunden ist. Darüber hinaus ist die Klinik eng in europäische Strukturen eingebunden. Zahlreiche Fachleute aus Wien arbeiten in Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Europäischen Arzneimittelagentur mit, beraten zu Studienprotokollen und Zulassungsstrategien und tragen dazu bei, dass klinische Forschung europaweit harmonisiert wird. Dieser Austausch trägt wesentlich zu wissenschaftlichem Fortschritt bei.
Ein neues Kapitel: Das Center for Translational Medicine
In unmittelbarer Nachbarschaft zur MedUni Wien und dem AKH wächst derzeit ein Gebäude, das die klinische Forschung in Europa neu definieren wird: das Center for Translational Medicine, kurz CTM. Auf einer Fläche von rund 14.000 Quadratmetern entsteht hier bis 2026 ein hochmodernes Zentrum, das Labor Produktions und Studienbereiche unter einem Dach vereint. Das Herzstück bildet die klinische Phase-1/2- Einheit mit rund 30 Betten. Dort sollen künftig sowohl gesunde Freiwillige als auch Patientinnen und Patienten untersucht werden – unter engmaschiger medizinischer Aufsicht, mit permanentem Monitoring und angeschlossener Intensivmedizin. Die Räume sind so konzipiert, dass auch Langzeitstudien sicher und komfortabel durchgeführt werden können. Direkt im Gebäude entstehen GMP-zertifizierte Bereiche, in denen Zell- und Gentherapien unter höchsten Sicherheitsstandards produziert werden können. Moderne Labore ermöglichen toxikologische Untersuchungen, und spezialisierte Plattformen bieten Zugang zu modernster Bildgebung, Massenspektrometrie und molekularbiologischen Analysen. Das CTM wird damit nicht nur ein Studienzentrum, sondern ein vollständiger Innovations-Campus. Über Brücken ist es direkt mit der Universität und dem Krankenhaus verbunden. So können Ergebnisse aus dem Labor unmittelbar in klinische Prüfungen überführt werden – und umgekehrt fließen Beobachtungen aus der Praxis rasch zurück in die Grundlagenforschung. Markus Zeitlinger beschreibt die Idee hinter dem Projekt so: „Wir wollen den Kreislauf zwischen Entdeckung, Anwendung und Erkenntnis schließen. Das neue Zentrum wird ein Ort sein, an dem sich Wissenschaft und Klinik gegenseitig beflügeln.“
Auch für Studierende wird das CTM ein Lernraum. Hier sollen junge Ärztinnen und Ärzte sowie Forscherinnen und Forscher die Möglichkeit erhalten, die gesamte Entwicklung eines Medikaments mitzuerleben – von der präklinischen Idee bis zur Anwendung am Menschen.

Partnerschaften, die Vertrauen schaffen
Klinische Forschung ist heute ohne Kooperation nicht denkbar. Die Wiener Klinik arbeitet deshalb eng mit Partnerinnen und Partnern in Österreich, Europa und darüber hinaus zusammen. Biotechnologie-Start-ups, internationale Pharmaunternehmen, akademische Spin-offs und öffentliche Fördergeber nutzen das Knowhow der Wiener Expertinnen und Experten, wenn es um Studiendesign, Pharmakokinetik oder regulatorische Beratung geht. Dabei versteht sich die Klinik als „One-StopShop“: Sie unterstützt Projekte von der präklinischen Planung über die Durchführung der frühen Phasen bis hin zu zulassungsrelevanten Studien. Die Erfahrung im Umgang mit europäischen und amerikanischen Behörden ist dabei ein wesentlicher Vorteil. So kann bereits in der Konzeptionsphase einer Studie berücksichtigt werden, welche Studienendpunkte, Parameter, Biomarker später für eine Zulassung entscheidend sein werden.
Dieses Zusammenspiel von wissenschaftlicher Präzision und pragmatischer Umsetzung macht die Wiener Universitätsklinik für Pharmakologie zu einem begehrten Partner – sowohl für universitäre Forschungseinheiten als auch für Unternehmen, die Innovationen verantwortungsvoll in die Klinik bringen wollen
Wien als Modell für Europa
Mit dem Center for Translational Medicine entsteht in Wien ein Ort, der weit über Österreich hinaus Bedeutung haben wird. Das Konzept steht exemplarisch für die Zukunft der medizinischen Forschung: interdisziplinär, patientenzentriert und auf nachhaltige Kooperation ausgerichtet.
Hier sollen neue Therapien schneller den Weg zu den Menschen finden, die sie brauchen. Hier wird die Ausbildung kommender Generationen von Ärztinnen, Ärzten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stattfinden. Und hier entsteht ein Modell dafür, wie klinische Forschung, Ethik und Innovation miteinander in Einklang gebracht werden können.
Schon heute gilt Wien in Fachkreisen als Symbol für verantwortungsvolle Arzneimittelentwicklung. Die Kombination aus medizinischer Expertise, moderner Infrastruktur und institutioneller Stabilität ist in Europa anerkannt. Das CTM wird diesen Standortvorteil weiter ausbauen und internationale Talente anziehen, die in einem Umfeld arbeiten wollen, in dem Exzellenz nicht Selbstzweck, sondern Dienst an der Gesellschaft ist.
Forschung mit Verantwortung
Die Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie der MedUni Wien steht für einen Gedanken, der aktueller ist denn je: Wissenschaftliche Innovation braucht Vertrauen – und Vertrauen entsteht nur dort, wo Kompetenz und Verantwortung Hand in Hand gehen.
Mit dem neuen Center for Translational Medicine wird Wien zu einem europäischen Knotenpunkt für Forschung, Lehre und klinische Anwendung. Klinische Studien schaffen die wissenschaftliche Grundlage dafür, dass neue Arzneimittel sicher und wirksam sind, bevor sie der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen. Am Ende geht es, so Markus Zeitlinger, „nicht um die Zahl der Studien, sondern um den Unterschied, den sie im Leben der Menschen machen“. Genau dafür steht die Wiener Klinische Pharmakologie – gestern, heute und in Zukunft.
Center for Translational Medicine
- Standort: MedUni Wien / AKH-Campus
- Fertigstellung: 2026
- Fläche: ca. 14.000 m²
- Kernstück: Phase-1/2-Studienzentrum
mit über 30 Betten unter der Leitung von
Univ.-Prof. Dr. Markus Zeitlinger - Ausstattung: GMP- und GLP-Labore,
Reinräume, modernste Bildgebung